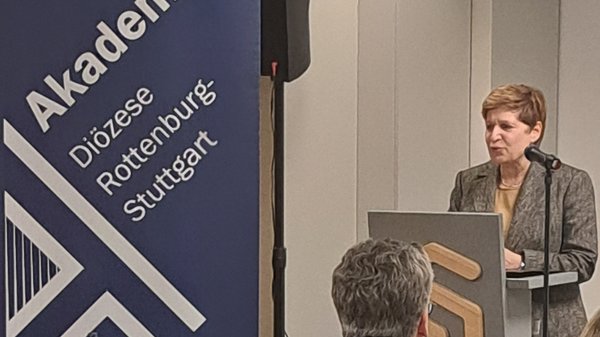Von Dr. Verena Wodtke-Werner
Das „Netzwerk Mehrwert – Nachhaltige Unternehmensethik“ ist entstanden aus einem Brainstorming von Kuratorium und Direktorin der Akademie, als branchenübergreifendes Gesprächs- und Begegnungsforum für die Wirtschaft in Baden-Württemberg. Am 15. Januar 2024 hat es im wahrsten Sinne des Wortes eine Behausung gefunden, für einen Abend jedenfalls: bei der Firma Schwörer, auf der tiefverschneiten Alb. Dabei waren auch Thomas Löffler als 1. Vorsitzender des Kuratoriums und Karin Schieszl-Rathgeb, die Leiterin der Hauptabeilung XI – Kirche und Gesellschaft beim Bischöflichen Ordinariat, die beide ein Grußwort sprachen.
Der Firmenchef selbst, Johannes Schwörer, Mitglied im Akademie-Kuratorium, hatte eingeladen und auch eine Unternehmensführung angeboten. Schwörer ist seit zwei Generationen europaweit im hochwertigen, seriellen Holzfertigbau tätig: ein echtes Familienunternehmen mit 1800 Mitarbeitenden, die der Chef alle kennt, und das schlüsselfertig baut. Im Jahr 2022 waren das 1000 Häuser – 2023 nur mehr 300. Auch auf der Alb ist die Baukrise angekommen!
Zwar waren bei unserer Veranstaltung alle von der Betriebsführung begeistert, denn so nah zuschauen zu können bei der Entstehung eines Holzhauses bis hin zum Aufladen auf den Lastwagen, das erinnerte an wunderbare Kindheitsstunden, wo man hingebungsvoll versunken Häuser bauen konnte.
Aber die Stimmung ist leider ganz anders als im verträumten Kinderzimmer. In der heute realen Welt haben wir eine echte und massive Baukrise, die nur gemeinsam gelöst werden kann. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Dimensionen: Am Abend bei Schwörer wurde deutlich, dass Häuser viel mehr sind als ein gemütliches Dach über dem Kopf. Sie sind Zufluchtsorte, Überlebensorte, Luxusorte, Wohlfühlorte, und sie sind evidente Wirtschaftsfaktoren.
Solide Wohnungen ohne Luxusstandards
Die baden-württembergische Bauministerin Ministerin Nicole Razavi zeigte sich bei ihrem Impulsvortrag grundsätzlich erfreut darüber, dass die Kirchen, wozu auch die Akademie im weiteren Sinne gehört, sich des Themas annehmen: „Ein Hoffnungszeichen am Beginn des Jahres, so etwas brauchen wir.“ Razavi versuchte zu verdeutlichen, dass die Baupolitik nur ein Rädchen im klemmenden Getriebe ist, dass sie als Ministerin Schrauben hat, an denen sie drehen kann, aber eben nicht allein. Bekanntermaßen helfe Digitalisierung beim Verkürzen der Antragsprozeduren, sagt die Ministerin; sie verweist auf zu hohe Anforderungen im Brandschutz, sie plädiert für Nachverdichtung statt Flächenfraß, auch für Aufstocken ohne weitere Auflagen (Stellplätze, Barrierefreiheit) , wie man das à la Schwörer mit Holzbau macht. Qualitätsstandards ließen sich variieren, statt Luxusbau überall betreiben zu wollen.
Es gibt viele Perspektiven, um den Bauvorgang zu verkürzen und zu erleichtern. Damit sind aber die Bauherren und Baufrauen noch nicht gewonnen, die nachweislich das Bauen und Vermieten scheuen, weil auch dort die Auflagen immer höher werden. Das Mietrecht ist in Deutschland so streng wie nirgends in Europa, die Fördermittel sind auf Null, die Auflagen dagegen auf ein Maximum geklettert. Allein Razavis Aufzählung der Punkte zeigt schon die angrenzenden, verstreuten Zuständigkeiten, und dass man nur mit allen zusammen etwas in der Politik bewegen kann – doch das funktioniert ganz offenkundig nicht.
Hochgetriebene Kosten und Gebühren
Der Unternehmer selbst, Johannes Schwörer, schaute in seinem Statement weiter zurück. In den 50er Jahren habe man massenhaft gebaut und dann geglaubt, sich anderen Themen und Technologien widmen zu können. Die Baufachleute wurden entlassen, orientierten sich um oder wanderten ab. Die Krise, so Schwörer, habe doch nicht erst mit dem jüngsten Krieg in Europa begonnen, auch wenn dieser zweifelsfrei steigende Energiekosten, auslaufende Förderungen und eine historisch hohe Inflation verursachte. Schwörer blickte auf die 90er Jahre zurück – Holzmann-Pleite, Walter-Bau –, als die Baubranche langsam, aber sicher auf Talfahrt ging. Schwörer kritisierte auch das politische Timing: Man könne ja die Krisen und die Verteuerungen infolge des Ukrainekrieges nachvollziehen, aber weshalb man dann auch noch die LKW-Mautgebühr und die CO2-Bepreisung oben draufsattle, die bei den Lieferanten die Preise hochtrieben, das verstehe er nicht mehr. Solche Preise könne er als Unternehmer nur weitergeben – und das würge den Konjunkturmotor ab. So waren es, wie oben erwähnt, 2022 noch 1000 verkaufte Häuser, 2023 nur mehr 300; Fortgang offen. Schwörer und Razavi schauten an diesem Abend also auch besorgt in die Zukunft; momentan habe man noch Auftragsbücher abzuarbeiten, aber die Talfahrt sei noch nicht am Ende, da nur wenige Aufträge hereinkämen.
Wohnung attraktiver als Dienstwagen?
Das Motto des Abends – Gemeinsame Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum – sorgte für reges Interesse. Das Publikum oben auf der Alb bestand insbesondere aus 30 Fachkolleg:innen der Immobilienbranche und der Politik. Die Leute mit investionsfreundlichem Blick müssen zusehen, dass sich Bauen und Vermieten auch lohnt. Dazu gehören beispielsweise AFA-Sätze von 10-15%, dazu gehören Fördermittel, die hohe Umweltstandards flankieren helfen, auch oder gerade für die Ertüchtigung des Bestandswohnbaus. Dazu gehören Maßnahmen, um freie Stückle in Dörfern bebauen zu können und nicht fünfzig Jahre zu bunkern.
Die attraktivste Idee mit historischem Flair kam aus dem Publikum: So erinnerte ein Gast an den Betriebswohnungsbau der fünfziger Jahre; manche erinnerten sich an die Eisenbahnerwohnungen oder diejenigen für Bergleute im Ruhrgebiert. Die Firmen damals hatten erkannt, dass bezahlbarer Wohnraum ein wesentlicher Standortfaktor war, durch den sie Arbeitskräfte gewinnen oder halten konnten. Firmen sollten heute auch als Bauherren auftreten, die leichtere und bessere Konditionen für Investitionen bekommen und sich so als Unternehmen an ihrem Standort attraktiv machen. Vielleicht ist die Wohnung demnächst wesentlich attraktiver als der dicke Dienstwagen?
An dieser Stelle können sich Kommunen, kirchliche Institutionen und Firmen zusammentun und Menschen gemeinsam eine Zukunft bauen helfen, die sich nicht nur auf das Häusle beschränken muss. Haus und Heimat gehören auch ein bisschen zusammen.