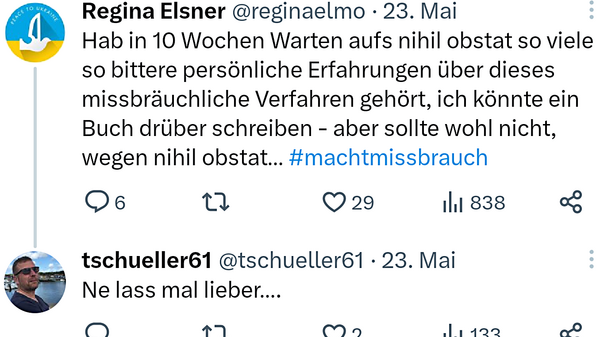Von Bärbel Janz-Spaeth und Verena Wodtke-Werner
Vor 30 Jahren startete – mit einer weiblichen Doppelspitze – an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart der Fachbereich „Frau in Kirche und Gesellschaft“. Da gerieten einige Sachen in Schwung: Es entstand das Hohenheimer Theologinnentreffen, und aus diesem heraus, fünf Jahre später, bildete sich „AGENDA“, als Forum katholischer Theologinnen. Initiiert wurde es formal als Tochterverein im KDFB (Kath. Deutscher Frauenbund) von Stefanie Spendel und Annette Schavan, die damals wichtige Funktionen im Frauenbund beziehungsweise im ZdK hatten. Seit 2004 gehört auch die kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) als zweiter großer katholischer Frauenverband fest zum Vorstandsteam dazu.
Unter dem Titel „Blick zurück und nach vorne“ hat AGENDA im April 2023 nun sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. 64 Frauen zwischen Anfang zwanzig und Mitte sechzig kamen nach Hohenheim; darunter waren auch einige der Mitbegründerinnen des Vereins und viele ehemalige Vorstandsvorsitzende, die Lehrstühle an katholischen Fakultäten innehaben oder hatten.
Blick zurück: AGENDA wird gegründet
Der Name Agenda war eine Notlösung, weil uns einfach kein anderer guter Name einfiel, wie die vielen Vorschläge in den Protokollen zeigen. Er wurde von Sr. Benedikta Hintersberger ins Spiel gebracht und angenommen – ohne in einem Protokoll aufzutauchen.
Die Dokumentationslage über die Genese des Vereins lässt ohnehin manche Fragen unbeantwortet; einiges konnte durch die Beiträge der Anwesenden geklärt werden. Der dialogische und humoreske Beitrag von Agnes Wuckelt und Wiebke Brandt am Festabend hat gezeigt, wie mühsam beide recherchieren mussten, um historisches Material auszugraben. Sogar das Gründungsdokument des Vereines war zunächst in Köln nicht auffindbar...
Alles begann mit dem Ausspruch der damaligen Redakteure des Lexikons für Theologie und Kirche gegenüber Stefanie Spendel und Annette Schavan auf deren kritische Nachfrage, warum man nicht auch Frauen Artikel im LThK schreibe lasse: „Frauen, die man fragen könnte, die gibt es ja nicht.“ Das war für beide genug Ansporn, die Frauen sichtbar zu machen, die es in der Fachtheologie sehr wohl gab! Schavans Strategie war von ihrer großen politischen Erfahrung geprägt: „Wenn wir etwas erreichen wollen, dann raus aus der Vereinzelung! Wir Frauen haben kein individuelles, sondern ein strukturell-politisches Problem, deshalb müssen wir einen Verein gründen und damit politische Aktivität zeigen!“ Der Erfolg des Vereins lässt sich nach 25 Jahren nicht nur an den wachsenden Mitgliederzahlen, sondern auch schon daran feststellen, dass es heute kaum eine Professorin in der katholischen Theologie gibt, die nicht AGENDA-Mitglied ist.
Agendas Schwestern
Grußworte beim Jubiläum kamen von der Vorsitzenden der European Society of Theological Research (ESWTR), Uta Schmidt, von der Spitze des KDFB und der kfd, von Bischof Gebhard Fürst, der die Gründung von AGENDA als damaliger Akademiedirektor sehr unterstützt hatte, und von der lateinamerikanischen AGENDA-Tochter Teologanda. Deren ehemalige langjährige Vorsitzende Virginia Azcuy hatte eine Grußmail geschickt; die neue Vorsitzende Gabriela di Renzo nahm persönlich am Treffen in Hohenheim teil. Der enge Kontakt zu den lateinamerikanischen Theologinnen war durch das große Netzwerk der Dogmatikerin Margit Eckholt ins Leben gerufen und über all die Jahre bei Tagungen, Besuchen, Kongressen gepflegt worden. 2003 gründeten die lateinamerikanischen Theologinnen das Netzwerk Teologanda; dieses arbeitet vertraut mit AGENDA auf vielerlei Ebenen zusammen.
Gabriela di Renzo machte deutlich, dass es in Lateinamerika nicht nur die üblichen katholischen Probleme sind, die es Theologinnen erschweren, ihre eigene Stimme zu erheben, sondern auch die tief in der Gesellschaft verankerte Machokultur. Diese Frauen empfinden AGENDA und Teologanda als sehr wichtige politische Stütze. Diese Stütze ist auch in anderen Ländern, besonders in osteuropäischen Ländern (Polen, Bulgarien) extrem wichtig und muss intensiviert werden. Wir erinnerten uns an den ersten „Internationalen Kongress zum Diakonat der Frau“ 1997. Dort hatten wir Frauen erlebt, die in der damaligen Tschechoslowakei im Untergrund zu Priesterinnen geweiht worden waren, um die Gläubigen begleiten zu können. Diese Frauen durften „natürlich“ nach Ende des Kalten Krieges unter Androhung der Exkommunikation den Dienst nicht mehr ausüben!
2019 – Die Junge AGENDA
Immer wieder kam in Hohenheim die Frage auf: Wie politisch will AGENDA noch sein, wie politisch will oder soll die Theologie sein? Oder schafft sie sich gerade selber ab? Diese Frage aus der aktuellen Politik stellte Dagmar Mensink deutlich in den Raum. Sie ist ZdK-Mitglied und Referentin für religionspolitische Grundsatzfragen der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, war AGENDA-Gründungsfrau und Referentin an der Akademie. Im Zeitalter der möglichen Reduktion katholischer Fakultäten, hoher Austrittszahlen aus beiden Kirchen und der Ablösung von Staatsleistungen sollte die Theologie das sehr ernst nehmen.
Alles scheint in der Tat nicht abgeräumt zu sein, sonst hätten sich im Jahr vor der Pandemie nicht Frauen unter 35 Jahren zur „Jungen AGENDA“ zusammengefunden, die mittlerweile 93 Mitglieder zählt. Die gegenläufige Bewegung – Erosion des Kirchensystems einerseits und hoher Zugewinn an jungen Theologinnen anderseits – lässt nach den Motiven fragen. Fühlen sie sich nicht mehr von der Gründerinnengeneration repräsentiert? Haben Sie völlig andere Probleme oder gibt es Altlasten von früher, die (noch) nicht abgeräumt sind? Alles stimmt:
Auch die junge AGENDA agiert entsprechend der Haltung aus den neunziger Jahren: „RAUS aus der Vereinzelung!“ Die Probleme sind teils gleich, teils ganz anders als vor 25 Jahren: So ist das Queer-Sein im Outing immer noch problematisch, die Kombination Frau, queer, Kirche nach wie vor gefährlich. Neue Kirchengesetze, etwa die Öffnungen im Arbeitsrecht, sind eine Sache, die Kirchen-Kultur – negative, hochwirksam diskriminierend, toxisch – eine andere.
Wir können die vier Berichte von Frauen der Jungen AGENDA sehr empfehlen. Sie vermitteln ein Gefühl dafür, wie die jungen Theologinnen gerade ticken. Soviel ist klar: Wenn Theologie und Kirche darauf nicht hören, ist diese Generation unwiederbringlich für die Kirche verloren.
Die Theologie als Wissenschaft erleben viele immer noch als ungeheuer vielfältig, breit bildend, existenziell von Belang. Sie sind aber nicht mehr bereit, „mit einer Rüstung unterm Radar zu fliegen“, sondern kehren vielfach der Wissenschaft und der Kirche als Arbeitgeber den Rücken. Einmischung in die private Lebensgestaltung bei gleichzeitiger Vertuschungskultur der oberen Leitungsebene in der Kirche lässt sie fliehen. Ebenso meiden sie zunehmend das System Universität, das nicht nur wegen prekärer Arbeitsverhältnisse und mäßiger Bezahlung sehr familienunfreundlich ist, sondern auch einer düsteren Zukunft entgegengeht: die Kirche schrumpft, der Bedarf an Hauptamtlichen mit ihr. Die jungen Frauen sehen sehr deutlich, was an Veränderung auch in den Fakultäten kommen wird und fordern, sie mitgestalten zu können.
Die Dialogwissenschaft Theologie wird ihrem Anspruch nicht mehr gerecht, weil bei geringen Studierendenzahlen kaum noch Dialoge möglich sind. Die jungen Frauen wünschen sich weniger, aber dafür qualitätsvolle und anspruchsvolle Fakultäten in Deutschland, nicht ein Durchwinken mäßiger Leistungen von Studierenden, nur weil man sich zahlenmäßig in der Abwärtsspirale befindet.
Die Kirche als Arbeitgeber ist aus ähnlichen Gründen noch viel weniger attraktiv; besonders das Hierachiegefälle im System wird als komplett unglaubwürdig und, angesichts der permanenten Skandale, als völlig unangebracht gemieden. Die „Aussteigerinnen“ erfahren sich dagegen als interessante Exotinnen in der freiberuflichen oder der wirtschaftlichen Sphäre, wo es mehr Interesse an ihrem Fach und an ihrem Christinnensein gibt als in der Kirche. Die Junge AGENDA hat weder das Fach Theologie noch ihre Spiritualität und Lebenslust aufgegeben, aber viele haben dem kirchlichen und dem universitären Kontext den Rücken unwiederbringlich gekehrt: „Es ist schon zu spät“, sagte eine Teilnehmerin, „da hilft kein Synodaler Weg mehr.“
Die Rüstung ablegen ist ein Emanzipationsschritt für viele junge Frauen, aber sie wollen nicht ohne ein selbstgeschneidertes Gewand ins Leben gehen, ein Kleid, das zu ihnen passt und dass sie selbst aussuchen können.
Nach Hohenheim sind sie aber gekommen und sie kommen auch wieder. Eine der Jungen AGENDA-Frauen ist in den neuen Vorstand gewählt worden. Sie versteht sich als Vertreterin ihrer Gruppe und wird neue Themen und Formate einbringen. Die Jungen sind spirituell, offen und politisch hoch motiviert. Wie können diese Inhalte Raum bekommen und AGENDA mitgestalten?
Ein „Dazwischen“ als Stärke
Prof.in Anna Noweck fragte: Wie legt man seine Rüstung ab? Will, kann, soll ich das überhaupt? Sie knüpfte dabei an ihre eigene Erfahrung an, die das Lebensgefühl vieler junger Leute heute trifft, nicht nur das der Frauen: „Aus meinem Dazwischensein wurde irgendwann ein kreatives Prinzip: Intersektionalität, Interkulturalität, Inter…..!“ Bezugspunkte waren die Texte afro-amerikanischer Frauen, die als Aktivistinnen, Feministinnen, Philosophinnen unterwegs sind und als Wissensinstanz auch die eigene Lebenserfahrung ins Feld führen. Hier erübrigt sich die Frage nach dem politischen Selbstverständnis.
Die verordnete weiblichen Schwesternliebe aus den achtziger Jahren ist einem pragmatischeren Umgang gewichen. Feministinnen müssen sich nicht lieben, sondern politisch-pragmatisch zusammenarbeiten. Nowecks Credo: „Schau auf Deine Erfahrung und vergleiche Dich nicht mit anderen.“ Auch hier besteht das Ziel im Zusammenschluss, denn die Rüstung ablegen geht mit dem Ziel der Kommunikation einher. Dafür braucht es aber unbedingt geschützte Räume für eine ungeschützte Selbstreflexion.
Oft fehlen Frauen dafür die richtigen Worte, weil es häufig traumatische Erfahrungen sind, die sich kaum in Worte fassen lassen. Prof.in Hille Haker, aus Chicago zugeschaltet, konnte ebenfalls von ähnlichen Fremdheits-Erfahrungen berichten, weil sie in einem anderen Land lebt und so auf unterschiedliche kulturelle Erfahrungen aufmerksam gemacht wurde. Sie leiht sich aus diesem Grund seit Jahrzehnten die Sprache von Kunst und Literatur und verweist auf eine Herangehensweise in Anlehnung von Paul Ricoeur: sprechen, erinnern, erzählen, handeln, Verantwortung übernehmen; politisch auftreten. Theologinnen so Haker, „sind politische Menschen und Vermittlerinnen des Glaubens.“
Erzählen schafft Gemeinschaften: „#Me too“ sind nur zwei Wörter, und trotzdem ist daraus eine Community entstanden, die weltweit für Gewaltlosigkeit und sichere Räume von Frauen auftritt. Wie Noweck, so bekundet Haker: Es braucht immer den gemeinsamen Raum, damit andere „me too“ sagen können. „In AGENDA steckt Handeln: agency – agere, was brauchen wir mehr? Wir müssen eine Sprache zwischen Dogmatik und Pastoral finden: literarische Sprache!“
Anna Hack stellte in ihrem Workshop Paradigmen und Tendenzen klassischer Frauenforschung und ihren Bezug zur Feministischen Theologie zur Diskussion. In ihren Thesen forderte sie unter anderem die Diskussion über die theoretischen Prämissen theologischer Geschlechterforschung und eine politisch-feministische Praxis ein. Die lebhafte Diskussion war davon geprägt, dass die Teilnehmerinnen ihre Perspektive aus unterschiedlichen Lebens-, Lehr- und Praxiserfahrungen einbrachten.
Prof.in Ines Weber zeigte, wie solche „safe spaces“ auch an der Uni und im Leben aussehen könnten. Es geht um das Menschsein, besonders in der Theologie. Es geht darum, so etwas wie „gesegnete Entwicklungsräume für alle zu schaffen und zu finden". Ines Weber hat dafür ein eigenes Konzept der Persönlichkeitsentwicklung mit eigenen Coachingformen erarbeitet, die sie seit vielen Jahren mit jungen Leuten an der Uni anbietet und praktiziert.
Freiräume suchen oder gestalten war dann auch das Thema, das die Teilnehmerinnen fragen ließ, wie sich das nächste Hohenheimer Theologiennentreffen formieren muss, damit es dem Lebensgefühl, den Bedürfnissen und der Philosophie heutiger AGENDA-Frauen gerecht wird.
Offene Gesprächsformen sind den Frauen sehr wichtig, und ein bisschen soll von allem dabei sein: Es genüge, Rahmen vorzugeben, der Rest ist im Raum. Talente sollen sichtbar, Jobbörsen angeboten werden; fun facts dürfen auch nicht fehlen: „Weniger Hirn, mehr Körper!“, war irgendwo zu lesen.
Mehr Kontroversen forderten einige: Es dürfe auch mal wehtun! Dazu gehörten auch Tabuzonen: Wie können wir auch dort klare Machtgefälle thematisieren, nicht unter den Tisch kehren, offen legen? Denn im Raum werden immer Frauen sein, die als tatsächliche oder potentielle Arbeitgeberinnen einfach dabei sind.
Die Frauen wollen offene Räume, agile Räume, Ruheräume, sichere Räume, Naturräume. Manche wollen durchaus auch einen thematischen Fokus, aber doch frei von Denkverboten, und ganz wichtig: Spirituelle Räume. Es werden junge Referentinnen gewünscht, die das eigene Lebensgefühl repräsentieren, die zwischen den Sektionen welcher Art auch immer denken, reden und leben und die Perspektive weit machen. Dazu gehört es aber auch, generationenparitätisch zu sein, Spannungen und Konkurrenzen nicht unter den Tisch zu wischen, sondern wahrzunehmen. Es soll offen, ergebnisorientiert und körperlich zugehen.
Wir haben uns gefragt, ob all das in einem einzigen Treffen umzusetzen ist oder frau dazu mehrere Settings braucht? Interessant war für uns der mehrfache Wunsch nach Kinderbetreuung. Das wollten die Vorgängerinnen früherer Generationen irgendwann gar nicht mehr. Sie wollten ganz frei davon sein; zumindest für 2 Tage!
Letztlich ist das „Dazwischen“ ein neues Sein, das von vielen jungen Frauen überhaupt nicht als orientierungslos verstanden wird, sondern auch oft als Freiraum zum Experimentieren, sich selbst kennenzulernen und sich immer wieder neu zu (er)finden. Die Theologie mit ihrem Narrativ der täglichen Auferstehung und der creatio continua passt ziemlich gut dazu!
Dipl. theol. Bärbel Janz Späth, Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart, Fachbereich Theologie, HA Kirche und Gesellschaft
Dr. theol. Verena Wodtke-Werner, Akademiedirektorin