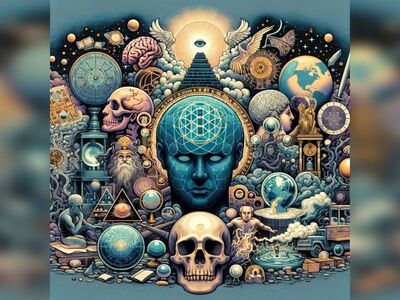Von Heinz-Hermann Peitz
In der globalen Medien- und Meinungslandschaft sind Falschinformationen, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien allgegenwärtig. Sie speisen sich nicht selten aus Ablehnung der „Mainstream“-Wissenschaften und berufen sich ihrerseits auf „alternative Fakten“. Ein idealtypisches Beispiel dafür ist die Ablehnung der Evolutionstheorie, was beispielhaft für die Konflikte zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft steht.
Auch die Auseinandersetzungen um Klimawandel oder Corona-Pandemie haben die wissenschaftliche Community herausgefordert, Kriterien zu benennen, um Wissenschaft von Pseudowissenschaft abzusetzen. Wo sind die Grenzen zwischen gesundem wissenschaftlichem Zweifel und grundlegender Wissenschaftsskepsis oder Wissenschaftsleugnung?
Aber auch das Gegenteil, die Vergötzung der Wissenschaft, ist eine Engführung. Sie orientiert Weltanschauungen und gesellschaftliche Entscheidungen ausschließlich an den Erkenntnissen „der“ Wissenschaft und übersieht, dass die Welt mehr ist als das Empirische.
Wie also ist Wissenschaft gesellschaftlich so zu positionieren, dass sie (öffentlichkeits-)wirksam gegen Faktenleugnung ins Feld zieht, ohne das Gegenteil der Wissenschaftsvergötzung zu fördern? Drei akademische Perspektiven versuchen, diese Frage zu beantworten.
Beispiele Kreationismus und Intelligent Design
Der Molekularbiologe Andreas Beyer gibt einen Überblick über Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien, die er von empirischen Wissenschaften abgrenzt – ohne in einigen Fällen fließende Übergange zu bestreiten. An den Mythen über das Impfen, über AIDS, Mondlandung und Chemtrails führt Beyer beispielhaft pseudowissenschaftliche Argumentationen und mögliche Gegenargumente vor.
Exemplarisch stellt Beyer die evolutionskritischen Argumente von Kreationismus und Intelligent Design auf den Prüfstand, unter anderem die Behauptung der “irreduziblen Komplexität” biologischer Systeme. Diese besagt, dass eine evolutive Erklärung derart komplexer Systeme unzureichend ist, und dass nur der Eingriff eines intelligenten Designers die Entstehung der Konstruktion und der Stoffwechselsysteme von Lebewesen erklären kann. Beyer hingegen argumentiert, dass “irreduzible Komplexität” die Möglichkeit einer natürlichen Entwicklung in einzelnen Schritten nicht ausschließt.
Theologie: Glaubenswissenschaft oder Pseudowissenschaft?
Der Systematische Theologe Florian Baab stellt klar, dass eine Theologie als Wissenschaft möglich und nötig ist, und grenzt sie deutlich sowohl von Naturalismus als auch von Pseudowissenschaft ab. Anders als Pseudowissenschaft habe die Theologie einen intersubjektiven Anspruch durch ihr Eingebettetsein in eine Glaubens- und Wissensgemeinschaft. Und: Seriöse Theologie unterwerfe sich wissenschaftlichen Standards. Sie verzichte als prozessuale Wissenschaft ferner auf Endgültigkeit, anders als (manche) Pseudowissenschaften.
Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien in der Corona-Krise
Als Soziologe hatte Alexander Bogner die Aufgabe, die Coronazeit wissenschaftlich aufzuarbeiten und dabei auch die Wissenschaftsskepsis zu analysieren, wie sie sich in ihrer Extremform beispielsweise in der Querdenkerszene artikulierte. Für Bogner gehört die Wissenschaftsskepsis einerseits zur DNA der Wissenschaft, sie radikalisiere sich aber etwa in libertärem Denken und Querdenkertum gegen die „Mainstream“-Wissenschaften. Nicht zuletzt kurbele eine szientistische Rhetorik der Alternativlosigkeit die Skepsis gegenüber der Wissenschaft an. Ein Misstrauen gegen den Kern der Wissenschaften sei dabei dialogresistenter als ein Misstrauen gegen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik bzw. Wirtschaft.
Die Dokumentation der Tagung – Vorträge und Diskussionen – finden Sie hier.