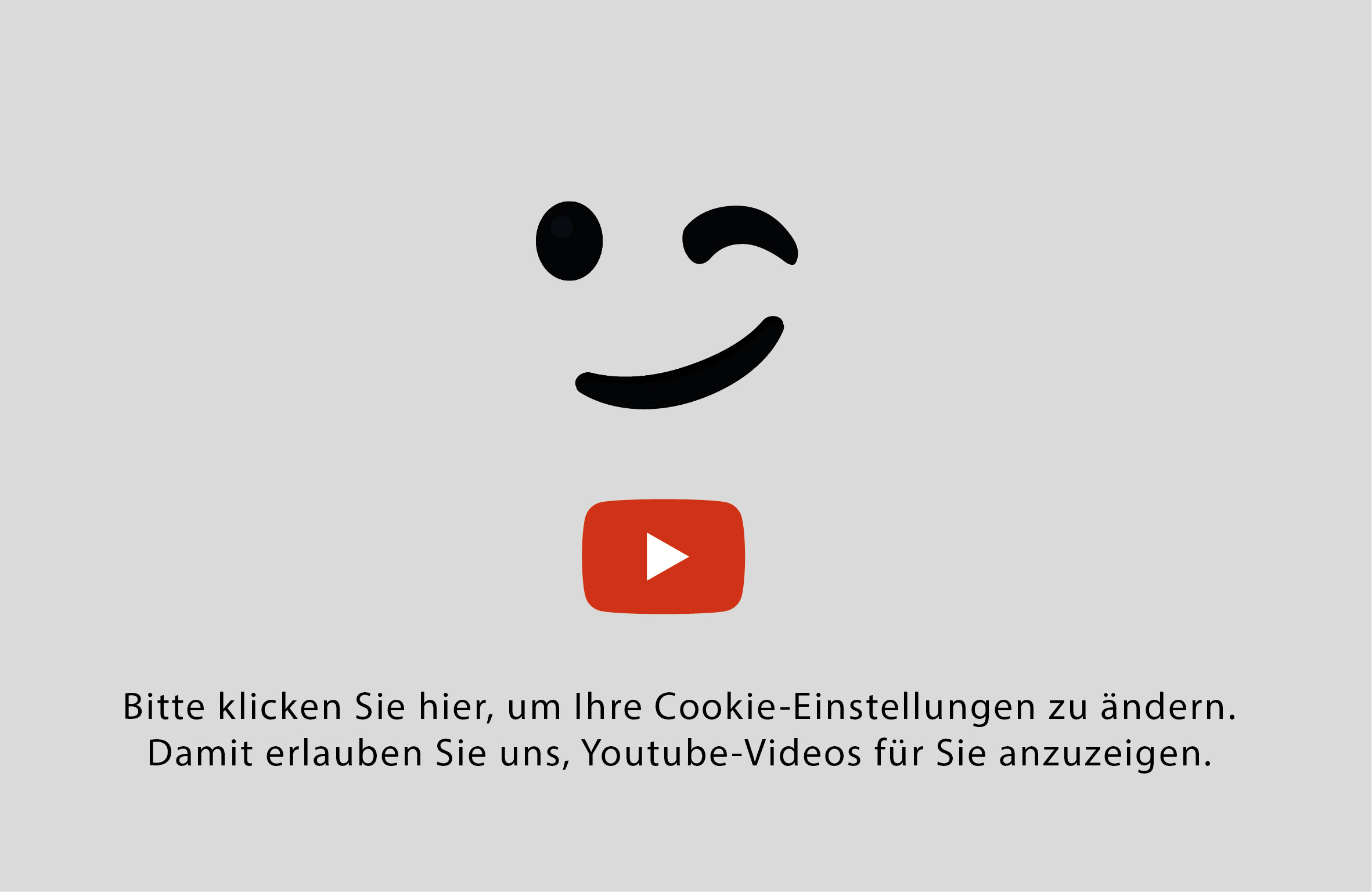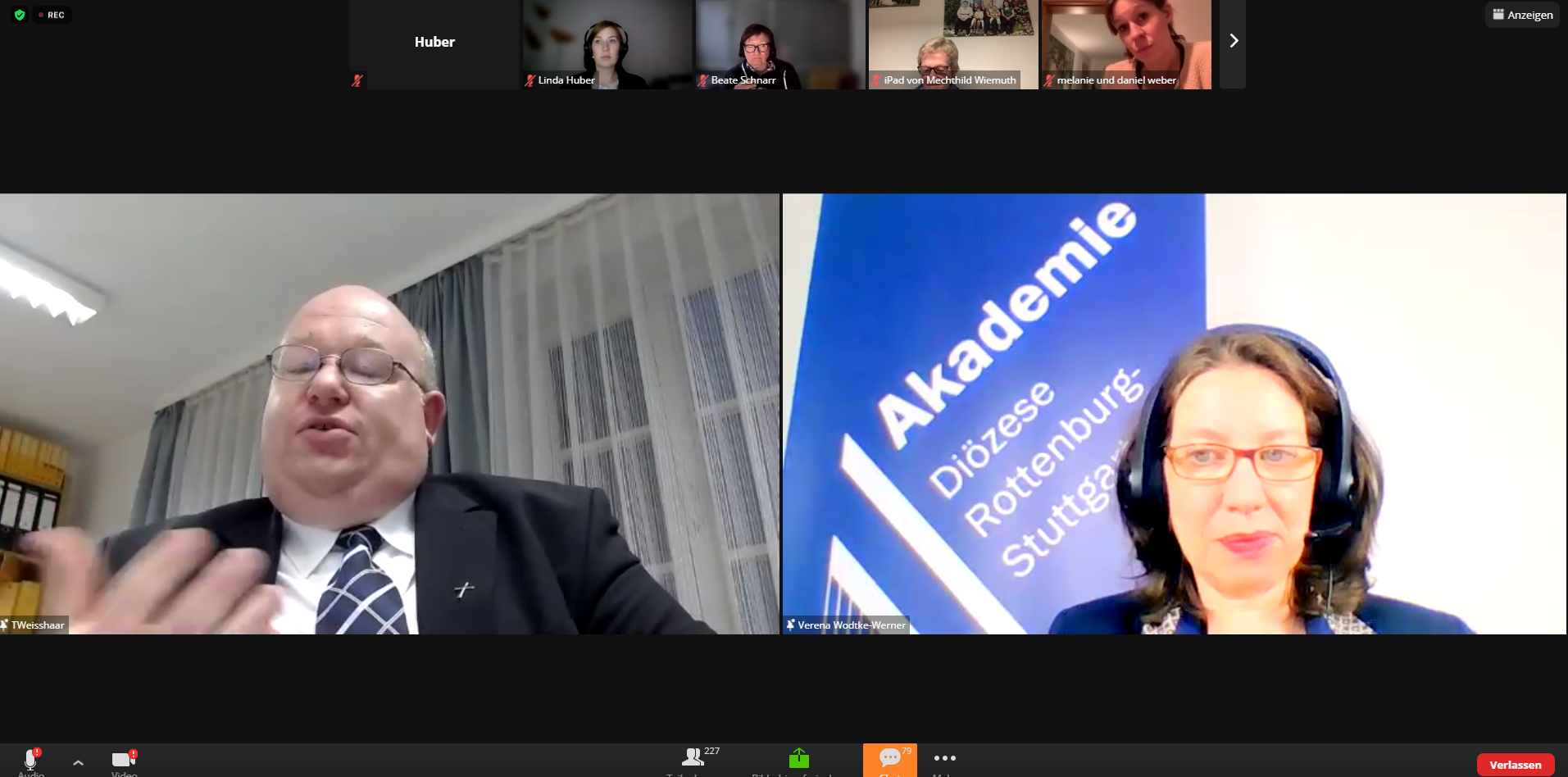„Brüder im Nebel“ war eine Geheimakte des verstorbenen Joachim Kardinal Meisner betitelt, in der er sexuelle Verfehlungen von Klerikern seines Kölner Erzbistums gesammelt hat. Diese ominöse Akte wurde bekannt durch das Rechtsgutachten der Kölner Strafrechtskanzlei Gercke zum sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese. „Brüder im Nebel“ lautete denn auch der Titel der Akademie-Veranstaltung zu dem Thema, bei der Offizial Domkapitular Thomas Weißhaar im Gespräch mit Akademie-Direktorin Dr. Verena Wodtke-Werner das Kölner Gutachten kirchenrechtlich analysierte und mit der Situation in der Diözese Rottenburg-Stuttgart verglich. Weißhaar, der Theologe und Priester ist, aber auch eine kirchenrechtliche Ausbildung hat, ist als Offizial der Leiter des kirchlichen Gerichts der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er ist zwar direkt dem Bischof zugeordnet, aber nicht weisungsgebunden. Das Interesse, mehr über das Gutachten und seine Bewertung zu erfahren, war enorm groß. Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen deutschsprachigen Raum hatten sich online dazu geschaltet.
Das 800 Seiten starke Kölner Gutachten bewertet nach Weißhaars Aussage Pflichtverletzungen rund um das Thema sexueller Missbrauch aus strafrechtlicher und kirchenrechtlicher Sicht. Der Zeitraum der Untersuchung geht von 1975 bis 2018 – warum genau diese Jahre in den Blick genommen wurden, wird nicht erklärt, es war den Gutachtern vorgegeben. Der Zeitraum ist nicht identisch mit der wissenschaftlichen MHG-Studie und erschien Weißhaar etwas willkürlich. Juristisch begutachtet und bewertet wurden bekannt gewordene Fälle möglichen sexuellen Missbrauchs von Klerikern und pastoralen Mitarbeitenden anhand kirchlicher Akten und einschlägiger Leitlinien. Die Gutachter mussten laut Auftrag nicht nur sichten, auswerten und zählen, sondern sollten auch Vorschläge zur Beseitigung festgestellter Defizite und Rechtsverstößen machen.
314 Fälle werden dokumentiert
Weißhaar stellte die Struktur des Gutachtens vor: Von den Grundlagen der Begutachtung über die Leitfragen, die Grenzen der Untersuchung, die Aktenauswertung die empirische Fallermittlung ging es bis hin zur Organisation des Erzbistums im Hinblick auf die relevanten Verantwortungsträger bei der Behandlung von Missbrauchstätern. Allein die Rechtsgrundlagen machen in dem Gutachten knapp 150 Seiten aus. Den breitesten Raum nimmt allerdings die Auswertung der Akten ein: Auf rund 400 Seiten werden Fälle und Pflichtverletzungen festgestellt, ihre Ursachen benannt und Handlungsempfehlungen aufgestellt. Demnach gibt es im untersuchten Zeitraum 314 dokumentierte Fälle, 127 beschuldigte Kleriker (das entspricht einem Anteil von 63 Prozent aller untersuchten Fälle), 66 beschuldigte Laien ( 33 Prozent) und neun beschuldigte Einrichtungen ( 4 Prozent). Betroffen von sexuellem Missbrauch waren demnach 178 Personen männlichen Geschlechts (57 Prozent), 119 Personen weiblichen Geschlechts (39 Prozent), keine Angaben gibt es dazu bei 17 Betroffenen (5 Prozent). Aufgeschlüsselt nach Alter waren 173 Kinder bis 14 Jahre (55,1 Prozent), 43 Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren (13,7 Prozent), 38 Jugendliche waren zwischen 16 und 17 Jahren (12,1 Prozent) und 59 (18,8 Prozent) Minderjährige unter 18 Jahren waren ohne genaue Altersangabe sowie ein erwachsener Schutzbefohlener (0,3 Prozent).
Weißhaar verwies darauf, dass ausschließlich Akten untersucht wurden; es gab keinen Kontakt mit den Betroffenen, und obwohl die Gutachter deutliche Hinweise hatten, dass auch Akten fehlen, gab es keine Versuche, weitere Erkenntnisse zu gewinnen durch die Befragung von Betroffenen oder des Interventionsbeauftragten des Erzbistums. Nicht untersucht wurde auch, ob es eventuell weitere Missbrauchsmeldungen gab, die sich nicht in den Akten finden.
Mit 125 Betroffenen wurde nicht gesprochen
Der untersuchte Zeitraum 1975 bis 2018 ist nicht identisch mit dem Tatzeitraum, sondern ist die Frist, in der die meisten Fälle bekannt geworden sind – das ist im Hinblick auf Verjährungsfristen nicht unerheblich. Die Gutachter sind Strafrechtler, die nach eigenem Bekunden ihrerseits Kirchenrechtler zugezogen haben. Doch deren Rolle bleibe schwierig und unscharf, sagte Weißhaar, denn ihnen sei zwar das Gesamtgutachten vorgelegt worden zu einer kirchenrechtlichen Bewertung. Doch diese Bewertung fehlt im Gutachten. Es ist also nicht klar, ob sie das Gutachten mittragen oder abweichende Bewertungen abgegeben haben. „Für mich bleibt ein Fragezeichen, inwiefern Juristen einen Gutachterauftrag übernehmen können, wo doch Theologen im Auftrag hätten einbezogen werden müssen“, kritisierte Weißhaar.
Die zu Tage geforderten Fälle von Missbrauch und sexualisierter Gewalt und objektiven Pflichtverletzungen bewertete Weißhaar insgesamt als „erschreckend“. Erschreckend sei auch, dass es nur mit 125 Betroffenen überhaupt ein Gespräch oder eine Anhörung gegeben habe. Auch zahleiche Beschuldigte wurden nicht mit den Vorwürfen konfrontiert, 117 Mal wurde überhaupt nicht vollständig aufgeklärt, das sind immerhin 46 Prozent aller Fälle. Weißhaar kritisierte, dass die Gutachter streng juristisch vorgehen mussten. Von einer umfassenden Aufarbeitung könne man deshalb nicht sprechen. Immerhin: Im Gegensatz zum ersten, von Kardinal Woelki zunächst nicht veröffentlichten Gutachten der Münchner Kanzlei Westphal Spilker Wastl,das nur 15 Fälle quasi exemplarisch herausgegriffen habe, hätten die Kölner Gutachter alle Fälle gezählt.
Im Gutachten werden verschiedene Pflichtverletzungen benannt. Es geht dabei etwa um die Anzeige- und Informationspflichten, die in den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz niedergelegt sind. Demnach müssen alle bekannt gewordenen Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergereicht werden – unabhängig von der Verjährungsfrage; und seit 2001 gilt: wann immer ein Kleriker einschlägig beschuldigt wird, muss das nach Rom an die Glaubenskongregation gemeldet werden. Da aber immer wieder strittig war, wer nach Rom melden muss, unterblieb es oft ganz.
Es geht um das 6. Gebot, nicht um Opfer
Ein großer Kritikpunkt am Kirchenrecht, so schilderte Weißhaar, sei, was als sexualisierte Gewalt angesehen wird. Denn das Kirchenrecht hat dabei nicht das Opfer im Blick, sondern nur das Vergehen des Klerikers gegen das sechste Gebot (Zölibat). Problematisch sind auch unterschiedliche Verjährungsfristen im staatlichen und kirchlichen Recht. So kann die Glaubenskongregation auch nach einer Verjährung noch aktiv werden, der Staat darf das nicht. Unterschiedlich ist auch der Umgang mit Opfern. Auch wegen dieser Gemengelage haben die Gutachter ein Ampel-Verfahren gewählt: Rot gab es für 24 klare Pflichtverletzungen, gelb für 103 Fälle, in denen Pflichtverletzungen nicht klar zugeordnet werden konnten, aber bei denen die Gutachter nicht überzeugt waren, dass alles ordentlich gelaufen sei und 109 Fälle wurden mit grün – keine Beanstandungen - markiert.
Für Weißhaar ist die Stärke des rein juristischen Blickwinkels auf Pflichtverletzungen zugleich auch die Schwäche des Gutachtens. Denn es fehle noch immer eine systemische Aufarbeitung. Das gelte auch für die Frage, wer wann was gewusst hat. Weißhaar stellt diese Frage auch im Hinblick auf das Wissen von Kardinal Woelki; der als Weihbischof Mitglied der Personalkommission war, in der Fälle besprochen wurden. Zudem war zuvor Geheimsekretär von Kardinal Meisner. Dass er auch in dieser Funktion von der Geheimakte überhaupt nichts gewusst haben will, leuchtet ihm nicht ein. „Das hat Meisner doch nicht persönlich gelocht und abgeheftet“, meinte er.
Weißhaar fordert andere Haltung der Kirche
Angesprochen auf die Verhältnisse in der Diözese Rottenburg-Stuttgart berichtete Weißhaar, dass die von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossene unabhängige Kommission, die sich mit jedem bekannt gewordenen Fall beschäftige müsse, noch nicht installiert sei. Es gebe auch bisher kein Gutachten vergleichbar mit Köln. Der Bischof müsse zwar jeden Kleriker-Fall nach Rom melden, er könne dann aber erst wieder handeln, wenn Rom entschieden habe. Wenn eine Missbrauchstat angezeigt wird, ermittle eine Juristin und berichtet dem Bischof.
Auf die Frage, was als Konsequenz aus dem Gutachten schnell präventiv umsetzbar wäre, bekannte Weißhaar, es erschrecke ihn sehr, dass das Bewusstsein fehle, dass Normen auch einzuhalten sind. Das Erzbistum Köln sei ja nicht ein x-beliebiges und der frühere Kardinal Meisner sei oft im Vatikan gewesen - er habe aber nicht nachgefragt und damit seine Aufgabe im Sinne des Rechts nicht wahrgenommen.
Weißhaar beklagte auch, dass es kein einheitliches Vorgehen gebe, man deshalb die Dinge nicht gut nachverfolgen könne und es an einer Verwaltungsgerichtsbarkeit fehle, mit Hilfe derer man Verwaltungshandeln nachprüfbar mache. Aber die Bischöfe seien derzeit an der Erarbeitung einer solchen Ordnung beschäftigt. Weißhaar sieht freilich noch viel umfassenderen Reformbedarf: Es müsse klar sein, was in Akten gehöre und was nicht und wie Akten sauber geführt werden. Zudem: Bisher urteilen Kleriker über Kleriker. Das müsste abgelöst werden, um auch schon dem Verdacht von männerbündischen Strukturen vorzubeugen. Klar geworden sei auch, dass den Kölner Verantwortlichen der Schutz der Institution Kirche wichtiger gewesen sei als die Betroffenen, nötig sei deshalb ein Perspektivwechsel: „Wie kann man Gerechtigkeit herstellen mit einem objektivierbaren Verfahren?“, fragte Weißhaar. In Köln habe sich der Offizial herausgehalten, „es gibt in vielen Diözesen Leute, die viel wissen, aber aus unterschiedlichsten Gründen nichts sagen, das ist wohl ein mentales Problem“, glaubt Weißhaar. Für ihn ist klar: „Der Schutz der Institution darf nicht mehr auf Platz 1 stehen. Da geht es um die Haltung, wie man solchen Fällen begegnet.“
(Barbara Thurner-Fromm)
Weitere Einschätzungen zum Kölner „Missbrauchsgutachten“
Der Jesuitenpater Klaus Mertes nahm dazu in einer Veranstaltung des Kath. Bildungswerkes Bonn am 29. März 2021 Stellung.
Mertes hatte 2010 eine Welle von Aufdeckungen sexuellen Missbrauchs an kirchlichen Einrichtungen ausgelöst. Für seinen Einsatz wurde er am 8. April 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.
Die Aufzeichnung können Sie hier sehen.