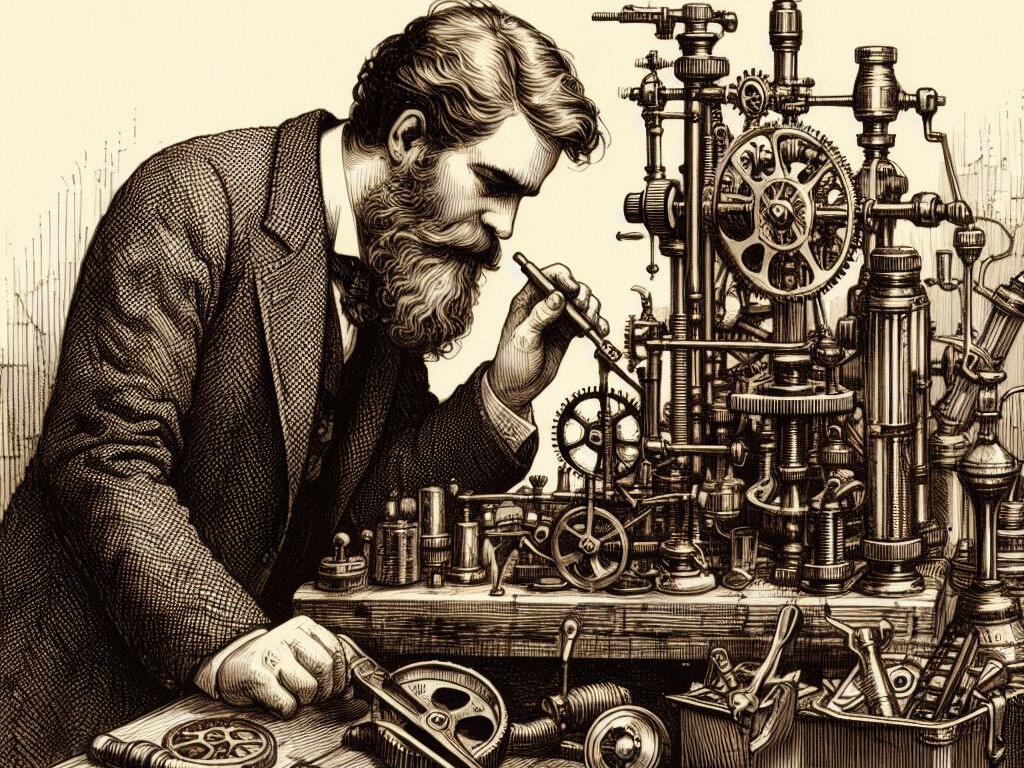Von Paul Kreiner
Dass „der“ Oberschwabe ein Tüftler sei (zum Gendern kommen wir später), hört sich gut an. Die Region Oberschwaben/Bodensee gilt seit mehreren hundert Jahren als wirtschaftlich solide und fruchtbar, das hat die Weingartener Tagung „Kulturen der Wirtschaft“, veranstaltet von Gesellschaft Oberschwaben und Akademie, gezeigt. Also muss es in der Gegend immer schon Menschen geben, die diese Wirtschaft kreativ, geistreich und sozusagen mit der eigenen Hände Schweiß vorantreiben. Die Tüftler, klar. Landestypisch. Knorrig und gut verwurzelt, in Dialekt und im genius loci.
So einfach aber ist das nicht. Das hat Dr. Georg Eckert von der Universität Freiburg bei seinem Abendvortrag in Weingarten herausgearbeitet. Dass es in Württemberg zu Zeiten des großen Industrie-Aufschwungs des 19. Jahrhundert mehr Patentanmeldungen gegeben hätte als anderswo, sagt Eckert, lasse sich nicht belegen. Und der regionale „Sonderboom“ im Wirtschaftswunder des 20. Jahrhunderts habe weniger mit Tüftlertum zu tun als mit Vertriebsstrukturen, Marketing und Kundennähe. Das Wort „Tüftler“ – das laut Digitalem Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) bis in die 1940-er Jahre praktisch nicht verwendet und zuvor interessanterweise über belletristische Literatur eingeführt worden ist – hat laut Eckert seine Bedeutung erst im späten 20. Jahrhundert erhalten, „dann aber mit Wucht“. Und eine „Tüftlerverherrlichung“ gebe es ohnehin erst seit zwanzig, dreißig Jahren.
Geschichte oder Narrativ?
Weniger Historie demnach. Mehr Marketing. Das aber gut ausgetüftelt – „und dann in der Fremdwahrnehmung Oberschwabens übernommen und verbreitet“, wie Eckert sagt. In der Region selber hat man gar nichts dagegen. Alleinstellungsmerkmal. Denn welche andere deutsche Landsmannschaft bekommt ein Tüftlertum attestiert? „Wir sind die Tüftler“, tönt Oberschwabens IHK-Präsident; auch auf der Website oberschwäbischer Unternehmer taucht dieses Narrativ gerne auf. Bei Kässbohrer, bei Liebherr zum Beispiel. „Das steht so da, das scheint keiner Erklärung zu bedürfen“, sagt Eckert. Aufstiegshoffnungen seien in solchen Erzählungen als – nun – erfüllt und als Teil des kollektiven Wunschbilds dargestellt. Und klar gab es in Oberschwaben schon lange „eine gewisse Häufung von Unternehmensgründungen“ mit beachtlicher „Dichte“ realer Aufstiegsstorys. Klar schwärmte Robert von Mohl in seinem württembergischen Staatslexikon Mitte des 19. Jahrhunderts vom heimischen Erfindergeist und schlug vor, die für „Gewerbende“ nötigen Tugenden „Geschmack und Erfindungsgabe“ noch stärker freizusetzen, indem Arbeiter zu Unternehmern werden und der Staat dafür Stipendien bereitstellen solle.
Innovation aber, so Eckert weiter, geschah auch in Oberschwaben häufig durch viel Kapitaleinsatz. Zum Beispiel durch Schweizer Ausgründungen (Escher-Wyss, Zeppelin). Oder durch „staatliche Clusterbildung“ (Weißenau). Tüftlergeist – also solchen nicht am grünen Tisch – wird man eher in anderen Aufstiegs-Unternehmen suchen müssen, oder in Menschen, die den Handwerksbetrieb ihres Vaters übernommen und zur (Groß-)Industrie ausgebaut haben, wie es im Schwäbischen nicht selten geschehen ist: zum Beispiel bei Karl Heinrich Kässbohrer, dem Sohn eines Schiffbauers, der Ende des 19. Jahrhunderts merkt, wie wenig Zukunft hölzernen Kähnen beschieden ist, der dann Wagnermeister, dann Ingenieur wird, dann in Ulm Fahrzeuge repariert, sich mit dem angesparten Geld dem Karosseriebau für ganz neuartige Fortbewegungsmittel widmet und 1907 seinen ersten „Omnibus“ zum Patent anmeldet.
Tüftler ist man, auch wenn man keiner ist
Oder Erwin Hymer: gelernter Werkzeugmacher, studierter Maschinenbauer, lernt bei Dornier den Umgang mit dem damals neuen Werkstoff Aluminium, macht in der väterlichen Werkstatt daheim aus landwirtschaftlichen Anhängern Häuser auf Rädern: Wohnwagen. Läuft.
Oder Conrad Magirus in Ulm, Sohn eines Manufakturbesitzers, stark in der Turner-Bewegung engagiert als einem Mannschaftssport und, gewissermaßen, als gesellschaftlich nutzbringende Tätigkeit: Aus Turnertruppen, so Eckert, hätten sich viele Feuerwehrmannschaften entwickelt, und mit seinen Turnern erfindet Magirus fahrbare (Dreh-)Leitern und noch mehr Feuerwehrgerät.
Und so weiter. Bei den „klassischen“ Tüftlern, sagt Eckert, gehe es wie bei Startups heute um Unternehmungen mit anfangs vergleichsweise geringem Kapitalbedarf, in der Regel um Fortentwicklungen aus bestehenden Milieus, mit vorhandenen Werkstoffen oder Geräten. Von ganz unten kam da keiner; die Startbedingungen in Oberschwaben waren so schlecht nicht. Und irgendwann hat das Narrativ durch fortlaufende Selbsterzählung seine Helden überholt. Eckert sagt: „Der oberschwäbische Unternehmer hat ein Tüftler zu sein, auch wenn er keiner ist.“
Nur, was ist, wenn jemand nicht reüssiert? Tja, räumt Eckert ein, das „Konzept Tüftler“ sei nicht sehr verliererfreundlich.
Und wie, fragt es am Ende aus dem Saal, war das mit dem Gendern? Mit den Tüftlerinnen? Mit so richtigen Beispielen kann Eckert da nicht aufwarten. Aber geben werde es sie schon. Wenngleich mit anderer Akzentsetzung: „Geschichten von männlichen Unternehmern werden erzählt, weil es Männer sind. Von weiblichen, obwohl es Frauen sind.“