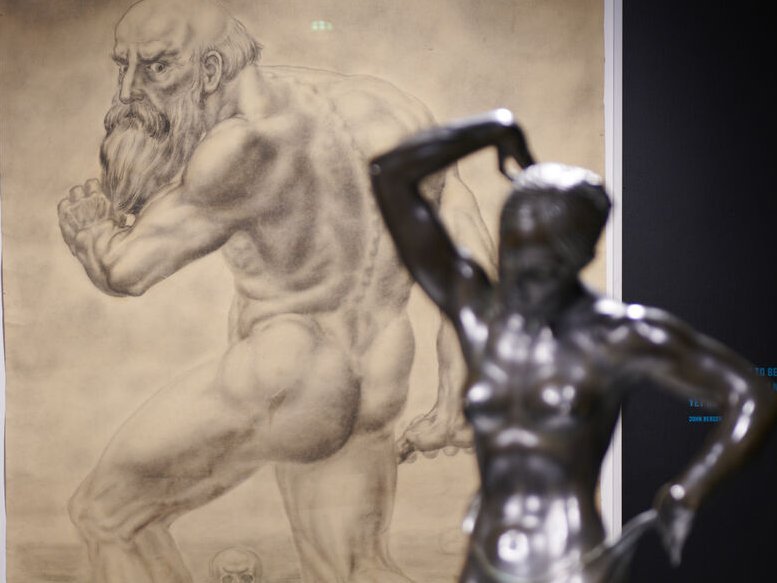Von L. Luica Graab
Jedes Mal wenn Henriette meinte, zu viel gegessen zu haben, machte sie einen Strich in ihr Tagebuch. In einem Monat kamen so über 60 Striche zusammen. Für ihre Verfehlungen bat sie Gott um Vergebung. Henriette war kein vom heutigen Frauenbild beeinflusstes Mädchen: Sie lebte im 18. Jahrhundert. Der Historiker Dr. Vitus Huber von der Universität Genf berichtete bei der Tagung des Arbeitskreises Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit in Stuttgart-Hohenheim von diesem sehr aktuell anmutenden Fall von Gewichtskontrolle und Selbstüberwachung. Unter dem Titel "Körper" reichten die Vorträge der elf ReferentInnen von Praktiken zur Selbstoptimierung und Körperwahrnehmung in der Frühen Neuzeit über theologische Debatten über die Geschlechtlichkeit Jesu, religiöse Moralvorstellungen und Kleiderordnungen bis hin zur Relation von Körper und Herrschaft. Auch das neue Forschungsfeld der Disability Studies fand Eingang in die Tagung. Die frühneuzeitliche Perspektive wurde durch Beiträge aus der Theologie (Prof. Dr. Anselm Schubert: „Christus als Androgyn“) und dem musealen Kontext (Dr. Carol Nater Cartier und Dr. Corina Bastian: „Badekult. Von der Kur zum Lifestyle“) ergänzt.
Mittel zum Machterhalt
Es zeigte sich, dass der Fokus der Tagung auf den Körper ganz neue Erkenntnisse ermöglicht – etwa auch zu der Thematik, wie Frauen ihren Körper zum Zweck des Machterhalts einsetzten, wie Christina Schröder von der Universität Bochum belegte. So versuchte beispielsweise die adlige Witwe Ernestine Leopoldine Juliane von Hohenlohe (1703–1776), ihren Herrschaftsanspruch zu wahren, indem sie eine Schwangerschaft simulierte. Der potenzielle Thronfolger sollte ihre Stellung sichern. Doch als kurz darauf ihre Hebammen feststellten, dass sie gar nicht schwanger war, verlor sie ihre Position – und ging ins Kloster.
Zeichen der Zugehörigkeit
Der Blick auf frühneuzeitliche Reisetagebücher wiederum machte anschaulich, dass die Beschreibung von Kleidung einerseits dazu diente, den Daheimgebliebenen unbekannte Kulturen näher zu bringen, und andererseits die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen unterstrich. Dies zeigte Malte Wittmaack von der Universität Bielefeld, indem er der Frage nachging, welche Rolle Kleidung und Geschlecht in der europäischen Wahrnehmung der Bevölkerung des Osmanischen Reiches (1553–1610) spielten.
Deutlich wurde bei allen Vorträgen, dass der Körper schon in der Frühen Neuzeit immer in einem Spannungsfeld von gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Handlungsmöglichkeiten stand. So bot er die Option, selbst aktiv sein Schicksal zu gestalten, war aber immer auch eine Grenze – etwa aufgrund von Geschlecht, Behinderung oder Alter.
Der Deutschlandfunk berichtete in der Sendung „Aus Kultur- und Sozialwissenschaften“ über die Tagung. Hier kann der Beitrag nachgehört werden.
Hier geht es zum vollständigen Programm der Tagung.