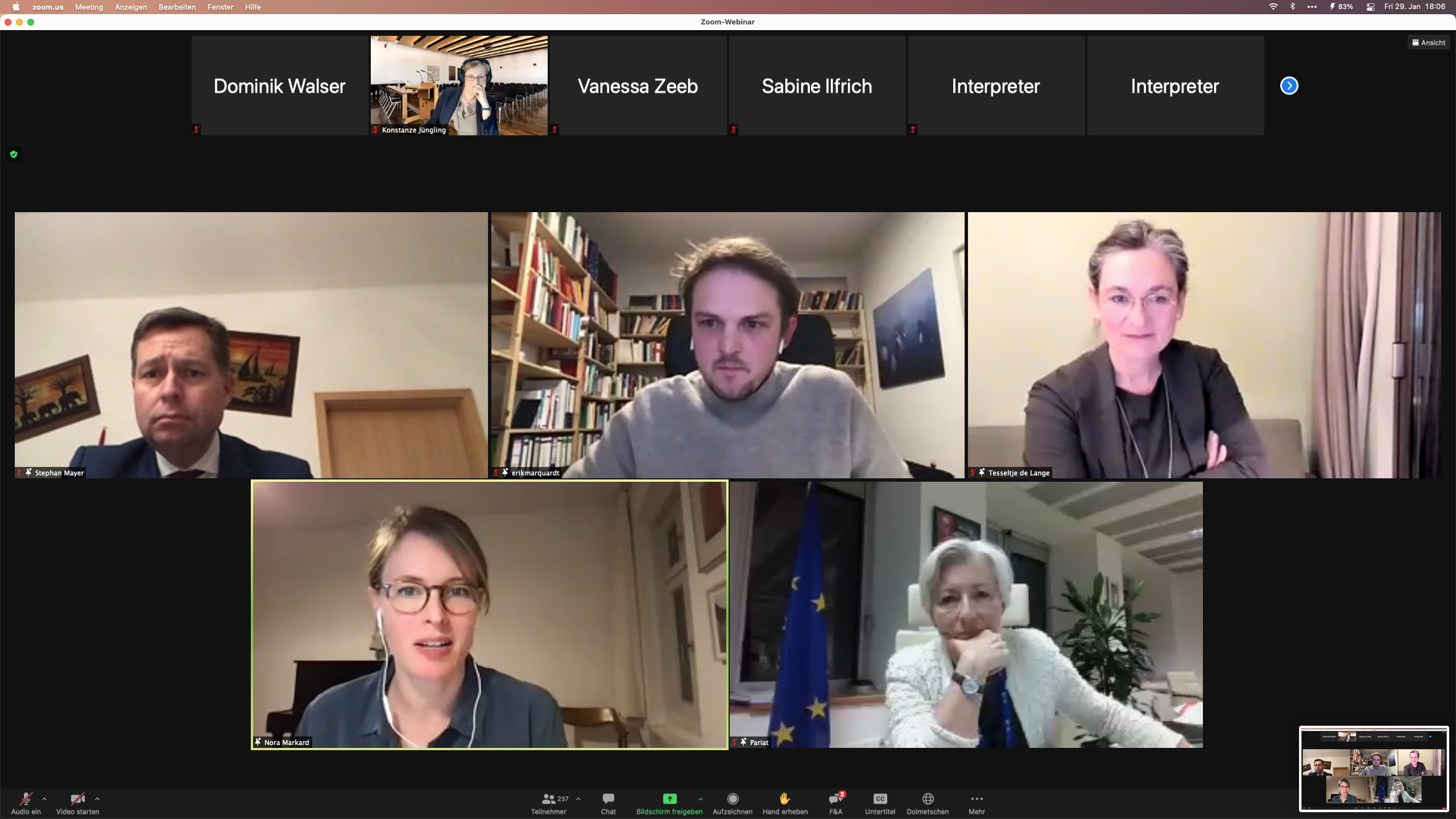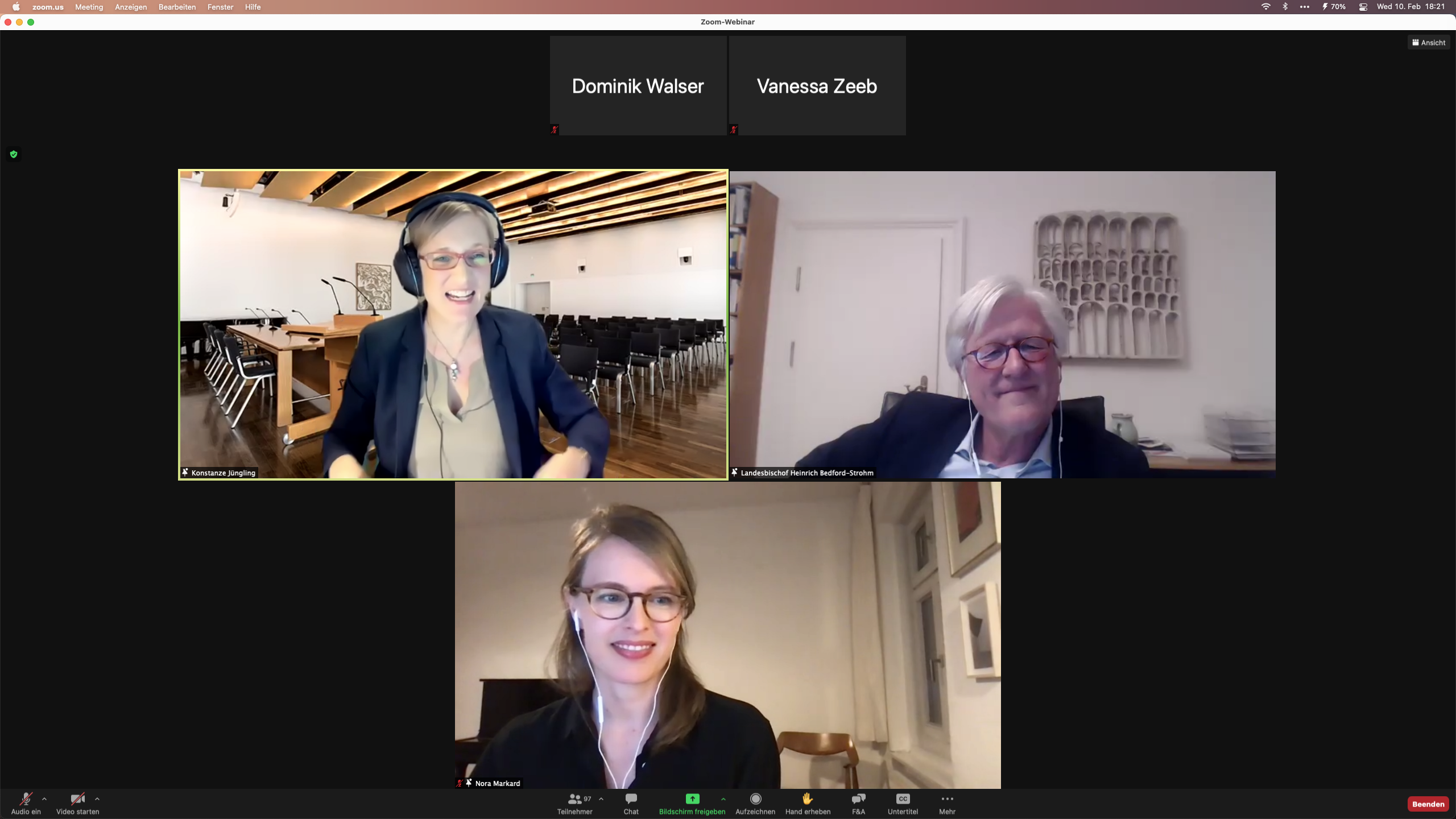Man kennt das seit vielen Jahren so: Jeweils am letzten Wochenende im Januar herrscht Hochbetrieb im Hohenheimer Tagungszentrum: aus allen Teilen der Republik und mit internationalen Gästen aus Europa treffen sich JuristInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und Mitglieder von NGOs, um über Asylpolitik und Migrationsrecht zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Dieses Jahr hat Corona der erfolgreichen Traditionsveranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die diesjährigen OrganisatorInnen, vertreten an der Akademie durch Dr. Konstanze Jüngling, wollten trotz der Pandemie nicht auf den Meinungsaustausch verzichten. Unter dem Motto „Migrationsrecht in Zeiten der Pandemie – Quo vadis?“ wurden die Hohenheimer Tage 2021 eben zum zweiwöchigen Online-Treffen mit insgesamt 16 Veranstaltungen internetgerecht aufbereitet – samt virtuellen Pausenräumen, die sprachlich an Hohenheim erinnerten: So gab es etwa ein RaucherInnenzelt und eine Denkbar.
Bilanz von 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention
Zum Auftakt wurde eine kritische Bestandsaufnahme des neuen Europäischen Migrations- und Asylpakets gezogen: Mit Monique Pariat, der Generaldirektorin für Migration und Inneres bei der EU-Kommission sowie dem parlamentarischen Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) vom Bundesinnenministerium war die Runde politisch hochrangig besetzt.
In einer Ganztagesveranstaltung wurde nicht nur Bilanz gezogen über 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, sondern wurden auch Herausforderungen und Lösungsansätze diskutiert. Darüber hinaus erörterten die Teilnehmenden die Staatsangehörigkeitsrechtsreform 2000 im Hinblick auf bisherige Erfahrungen und Perspektiven. 13 Workshops widmeten sich darauf aufbauend einzelnen Aspekten des weit gefächerten Tagungsthemas.
Bei der Frage, wie es mit der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union angesichts der Pandemie und nach dem Brand des Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos weitergehen soll, gab es interessante Informationen über den geplanten Bau eines neuen, bewachten Lagers für etwa 5000 Menschen auf der Insel weit weg von Ortschaften, irgendwo im Nirgendwo, aber nahe bei der zentralen Müllstation.
Die Ethnologin Dr. Jutta Lauth Bacas berichtete über massive Geldzuwendungen der EU, mit denen der Inselbevölkerung das Projekt schmackhaft gemacht werden soll. So erhalte Mytilini, das urbane Zentrum der Insel, zehn Millionen Euro für ein neues Strandbad und stimmte dem Projekt mit einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat zu. Auch die orthodoxe Kirche werde großzügig bedacht für die Sanierung ihrer Kirche. Zugleich solle damit aber darüber hinweg gesehen werden, berichtete Robert Nestler von der NGO Equal Rights Beyond Borders, dass die Menschen in diesem neuen Lager weit weg von urbaner Zivilisation, Gesundheitsversorgung und rechtsstaatlichen Möglichkeiten seien, um ihre Rechte geltend zu machen.
Wegen dieser Bedingungen gebe es auch Widerstand auf der anderen Seite der Insel in Westlesbos. Dort wehre man sich dagegen, zu einer „Gefängnisinsel“ zu werden. Der Bürgermeister von Westlesbos fordere die Evakuierung der MigrantInnen. Die Bevölkerung sei also stark gespalten.
EU will Abkommen mit Türkei wiederbeleben
Allerdings forcierten nicht nur die griechische Regierung die Pläne, sondern auch die EU, weil sie damit das EU-Türkei-Abkommen wiederbeleben will. Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 habe die Türkei niemanden zurück genommen. Im Januar habe die Türkei aber zugesagt, 1450 abgelehnte AsylbewerberInnen zurück zu nehmen.
Auf großes Interesse stieß auch eine Gesprächsrunde zur aktuellen Situation der privaten Seenotrettung.
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm, hielt dabei ein leidenschaftliches Plädoyer für die Notwendigkeit, Menschen im Mittelmeer aus Seenot zu retten. Allein im vergangenen Jahr sind über 1100 Menschen im Mittelmeer ertrunken.
Breites Bündnis für Engagement im Mittelmeer
Schon 2016 habe er im Rahmen der EU-Mission „Sophia“ die Bundeswehr auf der „Werra“ besucht, mit der Schlepperbanden zerschlagen werden sollten. Das Schiff hatte damals auch tausende Flüchtlinge gerettet und nach Sardinien gebracht. Dort habe er dann die Menschen getroffen - „Menschen mit Gesichtern“. Doch dann habe Innenminister Salvini die Seenotrettung eingestellt und Europa habe zugeschaut. Dabei seien die Staaten völkerrechtlich zur Nothilfe verpflichtet. Die einzigen, die geholfen hätten, seien aber private SeenotretterInnen gewesen, die jedoch diskriminiert und kriminalisiert worden seien. Daraufhin habe er die „ Seawatch 3“ besucht, sich mit dem Bürgermeister von Palermo zusammengetan und einen Appell verabschiedet, der von vielen politischen Kräften unterstützt wurde. Darin wird gefordert, die Kriminalisierung der privaten SeenotretterInnen zu beenden, einen europäischen Verteilungsmechanismus zu schaffen und faire Asylverfahren zu garantieren. Außerdem wurden die EU-Staaten aufgefordert, wieder selber zu retten. Beim Evangelischen Kirchentag in Essen sei dann die Idee geboren worden, zusätzlich ein Kirchenschiff ins Mittelmeer zu schicken. Der Rat der EKD habe es mit breiter Mehrheit beschlossen und mit breiter Unterstützung – etwa auch der Katholischen Kirche – sei das Projekt umgesetzt worden.
Bedford-Strohm berichtete von heftigem Gegenwind von KritikerInnen, aber auch von großer Unterstützung. Das Schiff „Poseidon“ wurde ersteigert, umgebaut und ist im vergangenen Sommer ausgelaufen. 353 Menschen habe es bei seinem ersten Einsatz gerettet, ist aber nach dem Einlaufen in Palermo festgesetzt worden und seither blockiert. Im Rechtsstreit darüber soll am 23. Februar entschieden werden, ob das Schiff wieder auslaufen darf. In Europa hätten sich 220 Kommunen bereit erklärt, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen; dies werde aber durch die nationalen Regierungen blockiert.
KritikerInnen der Mission argumentieren, private Seenotrettung führe zu einem „Pull-Effekt“, das heißt, es bewege Menschen erst zur Flucht. Dem widersprach Bedford-Strohm: Studien hätten diesen Zusammenhang nicht belegt. Außerdem bliebe die Frage nach Alternativen unbeantwortet. „Die Rettung von Menschenleben hat kategorische Qualität, man darf sie nicht ertrinken lassen. Man muss über Migrationspolitik reden, aber nicht anstatt zu retten“, sagte Bedford-Strohm.
Mit der ganz aktuellen Frage, wie es um die Pandemieprävention in den Gemeinschaftsunterkünften und Ankerzentren bestellt ist und welche Entwicklungen im Freizügigkeitsrecht zu beobachten sind, fanden die ungewöhnlichen Hohenheimer Tage dieses Jahr ein Ende. Immer wieder wurde in den unterschiedlichen Foren der gute Geist von Hohenheim beschworen. Ihn wach zu halten, war auch eine Absicht bei den großen technischen Anstrengungen, die für die diesjährigen Hohenheimer Tage unternommen werden mussten. Die große Zahl von BesucherInnen der Veranstaltungen hat aber gezeigt, dass sich der Aufwand lohnt.
Medienecho im Deutschlandfunk
Am 11. Februar 2021 in der Sendung Tag für Tag:
Das vegessene Thema – Hohenheimer Tagung zu Migration Anhören
(Barbara Thurner-Fromm)