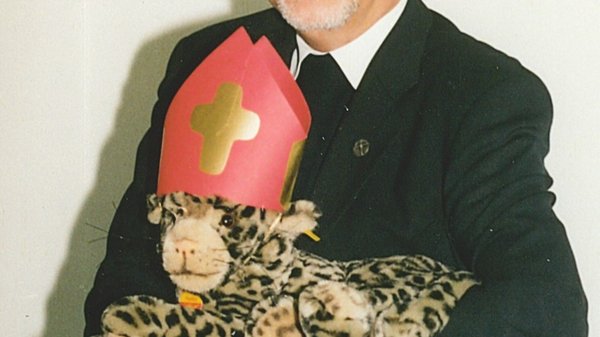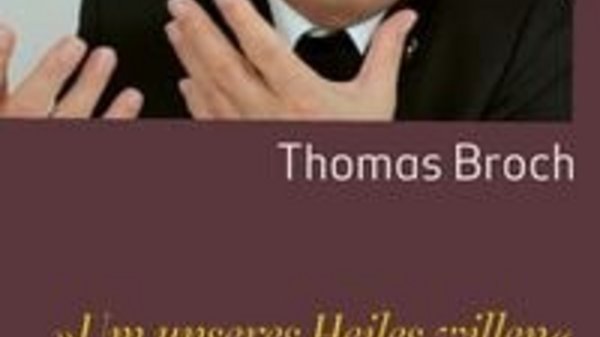Erinnerungen von Dr. Verena Wodtke-Werner
Bis zu seinem altersbedingten Rückzug an diesem Samstag, 3.12.2023, war Dr. Gebhard Fürst nicht nur der am längsten amtierende Bischof der drittgrößten Diözese Deutschlands, sondern er war auch sehr lange, nämlich 14 Jahre, Direktor unserer Akademie. Und ich war eine seine Mitarbeiterinnen von 1993 bis 2000.
Fürst ist also schon lange mein Chef in dieser Diözese. Nach Georg Moser war er der zweite Direktor, der die älteste katholische Akademie in Deutschland leitete und dann Bischof wurde.
Es gibt wohl auch keinen Bischof in Deutschland, der die Eigenständigkeit der Akademien, insbesondere der „eigenen“, immer wieder so hervorgehoben hat wie er. Fürst ließ nicht nach zu betonen, dass unsere Akademie nicht „katholisch“ im Namen trage und dass sie – nach einem Zitat von Bischof Moser – keine „Lehrkanzel des Bischofs“ sei. Die Unabhängigkeit der Akademie nicht nur vom Staat, sondern auch von der Kirche war ihm essentiell wichtig.
Die Akademie als „freier geistiger Tauschplatz“
Gebhard Fürst folgte damit dem Gedanken der Gründungsväter der konfessionellen Akademien, denen nach dem Faschismus eine Einrichtung als „freier geistiger Tauschplatz“ (Ernst Michel) vorschwebte, der in beide Richtungen denken kann und muss – frei und weit. Die Bedeutung der Akademie wird auch von der Tatsache untermauert, dass die Direktion Mitglied im Gremium der Kirchenleitung ist, dem der Bischof vorsteht.
Nur unter Wahrung dieser Eigenständigkeit war es Fürst möglich, deutliche Akzente in Richtung Staat und Kirche zu setzen – vielfach früher als andere. Viele Tagungen belegen das: Zu Asyl und Migrationsrecht beispielsweise, zur Entschädigung für Zwangsarbeiter, zum Verhältnis von Wirtschaft und Ethik. Oder auch: zum Diakonat der Frauen, zu den Reformvorstellungen des Kirchenvolksbegehrens, zum Missbrauch in der Kirche und vieles mehr
Früh erkannt, was in der Luft lag
Dieser Tage wird Fürst häufig als „grüner Bischof“ tituliert. Diese Zuschreibung hat ihren Anfang in seiner Zeit als Akademiedirektor. 1993 richtete er zwei wegweisende Referate ein: einmal das Referat Frau in Kirche und Gesellschaft, das ich selbst mit einer Kollegin innehatte, und das Referat Naturwissenschaft und Theologie unter Leitung von Dr. Heinz-Hermann Peitz, der sich schon damals und seither immer stärker mit Fragen der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung befasste.
Die erste Fotovoltaik-Anlage errichtete Fürst mitnichten 2002 auf dem Bischofshaus; bereits 1995 veranlasste er auf dem Tagungszentrum in Hohenheim den Bau einer solchen Anlage, als in Deutschland viele nicht wussten, was das überhaupt ist.
Die Frauenfrage in der Kirche und die Fragen zur Nachhaltigkeit waren seit den neunziger Jahren seine großen Anliegen. Dazu gehört auch der erste internationale Kongress zum Diakonat der Frau, der 1997 in Hohenheim stattfand. Aus ihm gingen das Netzwerk zum Diakonat der Frau hervor, der „prophylaktische“ Ausbildungslehrgang für Frauen zum Diakoninnenamt (mit Fürsts expliziter Unterstützung bei der Vereinsgründung in Hohenheim) und der Tag der Diakonin. Seine ungeheure Sensibilität für das Thema des sexuellen Missbrauchs und sein frühes Einrichten einer Kommission dazu als Bischof (2002) haben ihren Ursprung und ihre entsprechenden Publikationen in Tagungen, die wir schon in den neunziger Jahren an der Akademie veranstaltet haben – als eine der ersten Einrichtungen Deutschlands.
Die Akademie zu einer gefragten Institution gemacht
Alle Themen, die jetzt prominent in Kirche und Gesellschaft diskutiert werden, hat Gebhard Fürst schon Jahrzehnte zuvor an der Akademie promotet. Er hat die Zeichen erkannt und entsprechend gehandelt oder uns den Freiraum gegeben, sie bearbeiten zu können. Nicht aus institutioneller Eitelkeit, sondern weil er ein unverwechselbares Gespür hat, was in der Luft liegt und „dran ist“. Das feine Gespür für die Zeichen der Zeit hat er sicher immer noch, aber als Bischof war ihm nicht immer ein so freies Reden und Agieren möglich wie als Direktor der Akademie.
14 Jahre war Fürst unser Direktor – ebenso lange, wie ich in diesem Jahr die Akademie leite. 14 Jahre war er auch Vorsitzender des Leiterkreises der katholischen Akademien in Deutschland.
In seiner Zeit als Direktor haben sich unsere Fachbereiche zu wirklichen Fachstellen mit hoher Expertise entwickelt, die nach wie vor von staatlicher und kirchlicher Seite angefragt werden. Ohne unseren Bischof konnte und könnte die Akademie nie eine so qualitätsvolle und beachtete Arbeit leisten. Dafür dürfen wir ihm alle in der Diözese zutiefst dankbar sein!
Es bleibt nun zu hoffen, dass auch der Nachfolgebischof uns die bewährten Autonomie zugesteht, damit wir weiterhin gute und loyale Arbeit in beiden Sektoren, in Kirche und Welt, machen können.
Dr. theol. Verena Wodtke-Werner leitet die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart seit Oktober 2009
Er hat uns viel Freiraum gelassen
Erinnerungen von Dr. Rainer Öhlschläger
Es war im Jahr 2000. Das Kollegium unserer Akademie hatte sich gerade auswärts versammelt, auf einer externen Klausur in der Evangelischen Akademie Tutzing. Jedes Jahr leisteten wir unter der Leitung von Gebhard Fürst einen externen Blick auf unsere Arbeit. Unvermittelt aber verließ Fürst unsere Sitzung fluchtartig und fuhr mit seinem Audi ziellos viele Kilometer in Bayern herum. Das war seine Art, jenen Anruf zu bedenken oder zu verdauen, in dem er von seiner Ernennung zum Diözesanbischof erfuhr.
Ebenfalls noch im Jahr 2000 konnte Fürst Akademiedirektor den Alexsandr-Men-Preis für deutsch-russische Kulturbegegnung an Michail Gorbatschow vergeben, Laudator war Hans-Dietrich Genscher. Dieser Auftritt auf großer Bühne, Krönung jahrelanger Arbeit, war eine super Bewerbung zum Bischofsamt.
Den orthodoxen Priester Alexsandr Men hatte Gebhard Fürst bei einem Symposium 1991 in Weingarten kennengelernt. Dieser wurde kurz danach von russischen Nationalisten ermordet, und Fürst wollte ihm ein Denkmal setzen.
Vierzehn Jahre vorher hatte uns Bischof Georg Moser, vormals auch Direktor der Akademie, den jungen Gebhard Fürst, der gerade noch seine Doktorarbeit fertigschreiben musste, als Akademiedirektor präsentiert. Die achtziger Jahre - das war eine ganz turbulente Zeit: Sicherheit in Europa, Überwindung des Ost-West-Konfliktes, „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“, auch schon Migration. Unsere Akademie wurde mit diversen Veranstaltungen ihrer Verpflichtung zur Zeitgenossenschaft gerecht.
Es begann mit einem Spaziergang
Intern wurde aber auch gerungen um das passende Konzept, wie diese Zeitgenossenschaft inhaltlich und methodisch auszufüllen sei. Gebhard Fürst begann seinen Job mit einem Spaziergang mit dem Kollegium auf den Fildern. Wir haben ihm wahrscheinlich fast die Ohren abgequatscht, um ihn gewissermaßen mit unterschiedlichen Erwartungen zu impfen. Diese Erwartungen hat er als Akademiedirektor sehr gut moderiert. Er hat die Fachbereiche und die Referate in großer Freiheit und Eigenverantwortlichkeit gestärkt. Die Kolleg:innen durften anerkannte Expert:innen in ihren Schwerpunkten werden. Langfristige inhaltliche Linien sind bis heute erkennbar und geschätzt. Projekte wurden aufgelegt, in meinem Bereich zum Beispiel das „Dialogprogram Wirtschaft und Ethik“, „Lexikon der Witschaftsethik“ oder die „Weingartener Gespräche zu Lateinamerika, Asien, Afrika“.
Akademien waren für Gebhard Fürst nicht nur Formate, sondern auch Orte des Dialogs. Er schätzt die Ästhetik der – auch unserer – Tagungshäuser. Zeitgenössische Kunst findet dort ihren Platz. Fürst hat die Auseinandersetzung mit den Künstlern geliebt, bei der Entstehung der Kapelle in Weingarten ebenso wie bei jener im Erweiterungsbau des Stuttgarter Tageszentrums Hohenheim.
Mit Gebhard Fürst durfte ich mehrfach in Russland sein. Beim ersten Mal waren wir im Hotel Ukrainia untergebracht, ich im 10. Stock des Zuckerbäckerbaus, Fürst im 24., mitten im Gerümpel. Wir wollten alleine ins Außenamt der Russisch-Orthodoxen-Kirche im Danilow Kloster, zwölf Kilometer entfernt, keine Taxis, noch keine Autos auf Moskaus Straßen, kein Russisch. Wir trampten trotzdem. Ein kleiner LKW brachte uns hin, gegen einige Dollars.
Mit Gebhard Fürst konnten wir experimentieren, um dann und dadurch in den Referaten Profil zu entwickeln.
Dr. Rainer Öhlschläger war bis 2016 Leiter des Tagungshauses Weingarten und des Referats „Internationale Beziehungen“. Von 1981 bis 1987 Vorsitzender von Pax Christi Deutschland, von 2000 bis 2013 Geschäftsführer des Zentrums für Wirtschaftsethik.
Die Früchte seiner Zeit
Rückblick auf Gebhard Fürsts Wirken als Akademiedirektor. Aus der Jahreschronik 2000, von Uwe Renz und Abraham Peter Kustermann
Gebhard Fürst hat das Profil der Akademie als dialogorientierte „Kulturstation“ nachhaltig geschärft Verwurzelt im Glauben an Gott, den Liebhaber des Lebens, und gebunden an eine christliche Identität im Interesse des ganzheitlichen Gelingens der menschlichen Person im Kontext von Gesellschaft und Umwelt, versucht die Akademie bewusst und mit Sensibilität redliche Zeitgenossenschaft zu praktizieren, indem sie Anteil nimmt an dem, was sich „in der Zeit“ vollzieht und vorbereitet (Gebhard Fürst, 1991).
14 Jahre unter den Augen der Öffentlichkeit an einem vorgeschobenen Ort des Denkens und Sprechens. 14 Jahre „zwischen“ christlicher Botschaft und vielen Facetten weltlicher Realität. 14 Jahre in Verantwortung für eine katholische Akademie, jenseits von „akademischer“ Distanz zu den Dingen.
Vielfältige Begegnungen und Auseinandersetzungen haben in jedem Fall die gut 14 Jahre geprägt, in denen Dr. theol. Gebhard Fürst die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Direktor leitete. Damit hat der Theologe, Priester und heutige Bischof von Rottenburg-Stuttgart die seit Gründung der Akademie und damit seit den Tagen ihres ersten Direktors Prof. Dr. Alfons Auer unter wechselnden Stichworten gepflegte Tradition von Dialog und Gastfreundschaft, redlicher Zeitgenossenschaft, der Begegnung von Kirche und Welt fortgeführt und ihr dialogisches Profil nachhaltig geschärft. Das für die Festveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Akademie 1991 gewählte Thema „Dialog als Bedingung der differenzierten Gesellschaft“ spricht für sich – und muss für vieles sprechen, was in einer gerafften Würdigung des nun erledigten Direktorats hier nicht im Einzelnen berührt werden kann.
Auf Augenhöhe mit Zeit und Gesellschaft
Dabei ging es Gebhard Fürst nie um ein Offensein nach allen Richtungen um jeden Preis, gar um ein anbiederndes Anpassen christlichen, kirchlich-katholischen Denkens an die Oberfläche des Zeitgeistes, sondern um den konstruktiven Dialog und die sachliche Auseinandersetzung aus christlicher begründeter Position und Reflexion heraus. Sein Ziel war, mit der Akademie auf Augenhöhe mit Zeit und Gesellschaft zu bleiben: mit der Akademie und ihrer Arbeit in der, für die und als Kirche. Gebhard Fürst ist es wie nie zuvor gelungen, den Multiplikatoren in Gesellschaft, Kirche, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Akademie als Forum des offenen Gesprächs zu vermitteln und sie die Kirche als Raum aktueller und kompetenter geistiger Auseinandersetzung erleben zu lassen.
Die Kirche brauche neben „Sozialstationen“ fraglos auch „Kulturstationen“, argumentierte er 1997 (1999 verstärkt nochmals in einem Interview mit der Herder-Korrespondenz) und löste damit großes Echo aus, dem ebenso respektvolle Anerkennung seines „Modells“ von Akademiearbeit anzuhören war.
Hier sei jedem Ehrgeiz gewehrt, „Geschichte schreiben“ zu wollen: die Geschichte eines Direktorats, die Geschichte von ungefähr zwei Siebteln der Geschichte der Akademie insgesamt. Nur „Tupfer“ sind denkbar – Tupfer, die wenigstens exemplarisch von dem sprechen wollen, was in einer wirklichen Bilanz breiter darzulegen wäre. Vorwiegend schöne Geschichten wären zu schreiben jedenfalls! Ähnlich der Ton, der bekanntlich die Musik macht: Wer die chromatischen Tutti vermisst, soll doch den Cantus firmus nicht und nicht die über ihn gebauten Harmonien überhören! Denn ein freundliches Ständchen ist darzubringen! Gebhard Fürst war angetreten in der erklärten Absicht auf „zeitgemäße Erneuerung der originären Ideen“. Als Schwerpunkte seiner eigenen Tagungsarbeit hatte er ausgewiesen: Aktuelle Fragen von Christentum und Kirche in moderner Gesellschaft – Hermeneutik der Bibel und die Bedeutung des Wortes Gottes für Kirche, Gesellschaft und Kultur – Reflexion auf das Selbstverständnis der Akademie.
Neue Felder betreten
Das Bemühen, den Dialog stets auf der Ballhöhe des interdisziplinären geistigen Treibens zu halten, führte unter seiner Leitung immer wieder zu neuen Themenfeldern, die in den Tagungshäusern Stuttgart-Hohenheim und Weingarten bzw. in den Fach-Referaten der Akademie eröffnet wurden. So kam im Rahmen der drei Fach- Bereiche „Theologie – Kirche – Religion“, „Kultur und Geisteswissenschaften“ und „Gesellschaft und Politik“ 1993 das Referat „Theologie und Naturwissenschaft“ neu hinzu, das unter anderem ethische Fragen der Gentechnik und der Ökologie auf der Basis naturphilosophischen und theologischen Denkens behandelt. Dieses Engagement führte zu weiteren interdisziplinären Kontakten und zu konkreter Zusammenarbeit etwa mit der Akademie für Technikfolgenabschätzung des Landes Baden-Württemberg, in deren Kuratorium Dr. Fürst als Delegierter der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Freiburg berufen wurde.
Um den Erfordernissen der feministischen Forschung und Theologie gerecht zu werden, hat die Akademie ebenfalls 1993 ihr Engagement im Bereich „Frau in Kirche und Gesellschaft“ verstärkt und als eigenes Referat im Bereich „Theologie – Kirche – Religion“ ausgewiesen. Die Kompetenz dieses Referats konnte 1997 in den ersten internationalen Fachkongress zum Diakonat der Frau einfließen, der unter der Überschrift stand „Diakonat, ein Amt für Frauen in der Kirche – ein frauengerechtes Amt?“. Bis 1999 war Gebhard Fürst selbst Mitglied der „Frauenkommission“ der Diözese.
Als sich 1999 anbot, für absehbare Zeit religionssoziologische Fragen im Rahmen der Akademie stärker zur Geltung zu bringen, integrierte Gebhard Fürst diesen neuen Arbeitsschwerpunkt als Referat „Religion und Religiosität in der modernen Gesellschaft“, dessen Aufmerksamkeit den Prozessen der Transformation von Religion in der gegenwärtigen Kultur und Gesellschaft gilt.
Früh erkannte der Akademiedirektor, dass zum Dialog von Kirche und Welt auch der Dialog mit der Wirtschaft gehört. Bereits 1988, zwei Jahre nach dem Amtsantritt von Gebhard Fürst, begann an der Akademie das Dialogprogramm Wirtschaft und Ethik, das auf jahrelanger Vorarbeit im Arbeitsbereich Wirtschaftsethik aufbauen konnte. In Theologie und Ökonomie fand es große Resonanz, sein Ertrag mündete schließlich in das unter maßgeblicher Regie der Akademie 1993 erschienene Lexikon der Wirtschaftsethik.
Ein Raum für die Kunst
Als sich die Akademie Mitte der neunziger Jahre Fahnen mit dem Wortspiel „Kunst-Raum-Akademie“ vor ihre Tagungshäuser hängte, war dies weit mehr als ein Spiel mit Worten, mehr als ein Deco-Art-Gag. Die Begegnung mit der zeitgenössischen bildenden Kunst hatte hier schon immer einen Ort. Getreu dem Wort von Montesquieu „Nur selten kommt der Mensch durch Vernunft zur Vernunft“ nahm die Akademie also auch unter der Leitung von Gebhard Fürst ihren Weg der Spuren- und Wahrheitssuche nie nur rein rational, nicht nur text- und kopflastig, sondern auch in lebendiger Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst im Rahmen eines eigenen Referats, nun aber mit spezifischen Akzenten.
1988 wurden mit der Klasse Brodwolf die „Bildhauer-Symposien“ auf dem Weingartener Martinsberg inauguriert, die sich seither in zweijährigem Turnus folgen. Zwei Jahre später beteiligte sich die Akademie mit „Musikforen“ erstmals am Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd, was ebenfalls zur festen Tradition wurde. Im selben Jahr etablierte sie in Weingarten die alljährlich wiederkehrende „Sommerakademie Kunst und Kultur im Bodenseeraum“ – Zeichen ihrer Einwohnung in der oberschwäbischen Landschaft. Rasch feste Tradition geworden ist auch die erst 1999 eingeführte Reihe „Musik an der Akademie“.
Wenn in den 14 Jahren des Direktorats von Gebhard Fürst in Hohenheim oder Weingarten gebaut wurde, dann immer auf theologisch-philosophisch wie ästhetisch reflektierter Basis. Dies gilt speziell für die 1994 durch den Krefelder Künstler Josef Simon („Neues Sehen in alten Räumen“) neu gestaltete Kapelle im Tagungshaus Weingarten, die Gebhard Fürst in einer eigenen Publikation vorstellte, wie für die im Jahr 2000 fertig gestellte Erweiterung des Tagungszentrums in Stuttgart-Hohenheim. Immer stand als Leitmotiv die Begegnung von Christus und Menschheit, von Geist und Welt im Hintergrund.
Heilsam an Wunden rühren
So vorbehaltlos wie auf die genannten Felder begab sich die Akademie zwischen 1986 und 2000 auch auf schwieriges Terrain. Dazu gehört die deutsche Geschichte mit ihrer unseligen Vergangenheit des Nationalsozialismus und dessen schlimmen Folgen. Vorsichtig fragte eine von Gebhard Fürst veranstaltete Festakademie zum 70. Geburtstag des jüdischen Philosophen und Theologen Pinchas Lapide 1992 „Juden und Christen im Dialog? – Zum Stand des jüdisch-christlichen Gesprächs“ in Anwesenheit des Jubilars. Im Mai 1995 beehrte der Friedensnobelpreisträger von 1986, der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel, die Akademie und nahm an einem Symposion „Elie Wiesels Werk als Herausforderung für Religion und Gesellschaft heute“ teil.
1990 griff eine Hohenheimer Akademietagung zum ersten Mal explizit die Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern auf – und blieb diesem Thema auch weiter verpflichtet. Dank dieser Arbeit konnte die Diözese Rottenburg- Stuttgart am 10. November 2000 – durch Dr. Fürst, ihren nunmehrigen Bischof – als erste deutsche Diözese konkrete Namen von Zwangsarbeitern nennen, die in katholischen Einrichtungen auf ihrem Gebiet zwischen 1939 und 1945 beschäftigt waren.
Auf Tuchfühlung mit Russland
Ein Symposion noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs brachte Frühlingsglocken zum Schwingen: 1988 in Weingarten unter der Überschrift „Um der Menschen willen – Begegnungen mit der Sowjetunion“. Es war bereits das zweite Symposion aus Anlass der Taufe der Kiewer Rus’ vor 1000 Jahren. Aus diesen Kontakten, verstärkt zwei Jahre später durch ein deutsch-sowjetisches Literaten-Symposion, ebenfalls in Weingarten, entwickelte sich unter der Leitung von Gebhard Fürst eine intensive Beziehung zu Schriftstellern, Politikern und Gesellschaftswissenschaftlern auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion. Renommierte Autoren wie Tschingis Aitmatow, Daniil Granin und Aleksandr Men nahmen im Mai 1990 an der Tagung in Oberschwaben teil. Die Ermordung Aleksandr Mens durch russische Nationalisten ein halbes Jahr später ließ die Akademie ihr Engagement für Russland verstärken. So nahm der Reformpolitiker Grigorij Jawlinskij zusammen mit der Jabloko-Abgeordneten in der russischen Staatsduma Tatjana Jarygina 1994 die Einladung der Akademie zu einem zweiten Besuch an, bei dem beide Politiker zahlreiche deutsche Vertreter aus Politik und Wirtschaft kennen lernen konnten.
Ein Jahr später erfolgte erstmals die Verleihung des Aleksandr-Men-Preises für die deutsch-russische Kulturbegegnung – Stiftung der Akademie zusammen mit zwei Moskauer Literaturinstituten, dem Osteuropa-Institut der Universität Tübingen und dem Kreis der Freunde von Aleksandr Men – an die Gründerin und erste Direktorin des Moskauer Goethe-Instituts, Kathinka Dittrich van Weringh. Als weitere Preisträger folgten: der russische Schriftsteller Lew Kopelew (1996), der Slawist Wolfgang Kasack (1997), der kirgisische Schriftsteller Tschingis Aitmatow (1998), der Journalist Gerd Ruge (1999) und – als letzter unter der Regie von Gebhard Fürst – Michail S. Gorbatschow (2000).
Die Kontakte blieben fruchtbar, auch in umgekehrter Richtung: 1996 reisten südwestdeutsche Journalisten auf Einladung der Akademie und der russischen Freunde nach Osten und besuchten die Wolgastädte Nishnij Novgorod, Tscheboksary und Kasan, wo sie unter der Leitung von Dr. Fürst Kontakte zu Politikern, Religionsführern und Industrievertretern knüpfen konnten.
Blick über den Kirchturm hinaus
Direktor Fürst begnügte sich nicht damit, die Aktivitäten „seiner“ Akademie auf das Gebiet der Diözese Rottenburg- Stuttgart zu beschränken. Sein Engagement galt auch dem Miteinander aller Katholischen Akademien in Deutschland. Im Herbst 1993 wurde er zum Vorsitzenden ihres Leiterkreises gewählt. Diese Funktion, die ihn ebenso in ständigen Kontakt mit dem Leiterkreis der Evangelischen Akademien in Deutschland brachte, hatte Fürst inne bis zum Ende seines Direktorats, bis zu seinem Amtsantritt als Bischof im Herbst 2000.
Im Auftrag des Leiterkreises der Katholischen Akademien lud er 1996 zu einem Symposion nach Hohenheim ein: „Dialog als Selbstvollzug der Kirche – Dimensionen einer Theologie und Ekklesiologie des Dialogs“. Unschwer war auch hier die Handschrift des in Tübingen promovierten Theologen und Stuttgarter Akademieleiters zu erkennen: in der prägnanten Themenstellung, in der ekklesiologischen Zuspitzung eines tragenden Gedankens aller Akademiearbeit, in der theoretischen Reflexion kirchlich belangvoller Praxis.
Im Auftrag des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gestaltete die Akademie im Rahmen des Katholikentags 1994 das Großforum „... damit Menschheit überlebt“ in der Martin-Luther-Kirche in Dresden-Neustadt. Einsatz auf Bundesebene zeigte die Akademie auch im Jahr 2000, als sie sich im Verbund mit 19 Evangelischen und Katholischen Akademien auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover am Projekt „Weltverantwortung in den Religionen“ beteiligte und ein ganztägiges Forum „Standortfaktor Religion – Weltreligion Technik“ anbot.
Wie global und Grenzen überwindend das Denken und Arbeiten an der Akademie sich unter Dr. Fürsts Leitung ausprägen konnte, erweist sich auch durch das Aufgreifen von Themen wie Menschenrechte, Migration und Ausländerfragen. Tagungen für Juristen und Verwaltungsexperten aus östlichen Konversionsländern, Fachtagungen für deutsche Verwaltungsrichter, für EU-Beamte, für Flüchtlingsexperten gehören heute zum selbstverständlichen Programm der Akademie. Einen diskreten Beitrag zu mehr Frieden in Burundi leistete die Akademie 1991, als sich auf Einladung von Gebhard Fürst gesprächsbereite Repräsentanten verfeindeter Volksgruppen des afrikanischen Landes zu einem geschlossenen Kolloquium trafen, um Chancen für Demokratie und Menschenrechte auszuloten.
Wie das Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen in Deutschland gelingen könnte, darüber berieten Fachleute 1997 an der Akademie in Zusammenarbeit mit der von Hans Küng präsidierten Tübinger ‚Stiftung Weltethos‘ auf der Konsultationstagung „Weltethos konkret“.
Impulse für die Kirche
So sehr Gebhard Fürst als Direktor der Akademie auf die Kontakte mit Politik, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft achtete, so sehr gab er von Hohenheim und Weingarten aus Impulse für die Kirche nach innen. Wenn innerhalb der katholischen Kirche strittige Themen anstanden, bot die Akademie ein Forum für deren konstruktive Behandlung. „Störungen im deutschen Katholizismus“ hieß folgerichtig eine Veranstaltungsreihe, die 1989 begann und deren Premiere den Titel hatte: „Für eine dialogische Kirche – Anfragen und Perspektiven der Kölner Erklärung“. Mit der Kölner Erklärung prominenter deutscher Theologieprofessoren gegen die Ausuferung des römischen Zentralismus in der katholischen Kirche war damals eine Debatte entbrannt, die seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen ist.
Ende 1993 wurden an der Akademie mutige Überlegungen zur päpstlichen Enzyklika Veritatis splendor angestellt unter der Überschrift „Ist die Kirche auch heute ethisch noch bewohnbar?“. Renommierte Theologen, darunter der inzwischen verstorbene Münchener Theologe Heinrich Fries, beteiligten sich daran, analysierten die Enzyklika, zeigten Schwächen und Stärken auf.
Auch als die Bewegung Kirchenvolksbegehren auf mehr Basisbeteiligung und mehr Laienrechte in der Kirche drängte, bot sich die Akademie im Januar 1996 unter der Regie von Gebhard Fürst als Forum der gegensätzlichen Positionen an: „Was nun, Kirche – Zur Situation nach dem Kirchenvolksbegehren“.
Im Oktober des gleichen Jahres griffen die Akademie, der Lehrstuhl für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und deren Institut für Ökumenische Forschung den Themenbereich Kommunikation, Kompetenz, Kooperation wissenschaftlich auf und suchten nach trag- und konsensfähigen Perspektiven einer Communio-Ekklesiologie.
Geben und Nehmen an der Akademie in der Zeit ihrer Leitung durch Gebhard Fürst: Themen wanderten von außen in die Akademie ein und wurden die ihren, andere nahmen im Dialog von dort ihren Ausgang und fanden ihr Publikum auch draußen.
Das Geschäft mit den Medien
Dialog braucht Medien, und dies in mehrfacher Hinsicht. Gesellschaftlicher Diskurs erfordert zur Vorbereitung und Vergewisserung Medien in Form von Büchern, Bildern, Filmen, Tonbändern. Und er braucht Vertreter von Medien zur Verbreitung: Journalisten, Autoren – Medienschaffende eben. Bei-de Aspekte waren Dr. Fürst Anliegen und Ziel vieler Mühen. Während seiner Amtszeit hat die Akademie ihre Publikationsformen systematisch erweitert, die Zahl ihrer Publikationen selbst beträchtlich gesteigert. Dazu trägt ihr eigenes Auftreten als Verlag mit renommierten Autoren nicht unerheblich bei. Die Informationen, Diskussionen oder Ergebnisse vieler Tagungen liegen in Buch- oder anderer Berichtsform vor, die Jahres-Chroniken bieten breite Überblicke, der jährliche Pressespiegel zeugt von der Resonanz der Akademiearbeit in der Öffentlichkeit.
Mit den Medienvertretern baute die Akademie unter der Leitung von Gebhard Fürst ein intensives und vertrauensvolles Verhältnis auf. Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche und regelmäßige Einladungen zu den Veranstaltungen wurden selbstverständlich. Das darf und kann nicht anders sein, bietet die Akademie doch selbst in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten unter ihren „Seminarprogrammen“ einen mehrspartigen, zertifizierten journalistischen Ausbildungsgang an. Nach drei Jahren wachsender Zusammenarbeit konnten die Akademie in der Person von Dr. Fürst und die PH Weingarten in der Person ihres Rektors im November 1995 einen förmlichen Kooperationsvertrag darüber abschließen.
In die Amtszeit von Gebhard Fürst fiel schließlich auch der Eintritt der Akademie ins „global village“, die Chance weltweiter Kommunikation über das digitale Internet. Seit 1996 ist sie dort präsent, seit 1998 mit einer eigenen Homepage unter der Adresse www.akademie-rs.de. Das Angebot dort wächst ständig, mit jeder neuen Tagung, mit jeder neuen Publikation.
Dienst an Wort und Sakrament
Erstmals in der Amtszeit von Gebhard Fürst musste die Akademie mit nur einem Priester innerhalb ihres Stabs auskommen. Was an geistlichen Funktionen bis dahin zwischen Direktor und Akademie-pfarrer geteilt werden konnte, lastete nun ungeteilt auf seinen Schultern. Zuweilen war das kaum weniger an Verpflichtungen, als ein mittleres Pfarramt mit sich bringt. Doch war die Feier von Gottesdiensten für Dr. Fürst keine Last: der Vorsitz bei der Eucharistiefeier oder die Auslegung des Wortes Gottes in der Predigt. Im Gegenteil, er nahm sein priesterliches Amt mit fühlbarer Lust und Liebe wahr. Und so sprang der Funke meist rasch und leicht auf die Gottesdienstgemeinde über, nicht selten auch auf „Distanzierte“ unter den Teilnehmern.
Keine Frage, sondern innere Berufung war ihm, die ökumenische „Verfassung“ und Verpflichtung der Akademie weit obenan zu stellen. Der Priester drückte sie aus in weitherzig gewährtem Gastrecht bei den Gottesdiensten, der Direktor in den regelmäßigen Kontakten mit der Evangelischen Schwester-Akademie Bad Boll sowie in der Ermutigung zur Verhandlung ökumenischer Themen in der Akademiearbeit, der Theologe als Mitglied der Theologischen Kommission der ACK in Baden-Württemberg.
Gebhard Fürst war auch als Akademiedirektor ein geschätzter und gesuchter Prediger, der keine Predigt wiederholte und jede sorgfältig vorbereitete. So war er dazu prädestiniert, zum 50-jährigen Bestehen der Predigtzeitschrift „Dienst am Wort“ 1997 in die Akademie einzuladen und damit deutlich zu machen, dass Seelsorge zwar nicht ihr „Geschäft“, ihr aber mitnichten gleichgültig ist. Dabei waren die Gestaltungsmöglichkeiten für Gottesdienste an der Akademie innerlich wie äußerlich immer begrenzt: innerlich wegen des allfälligen Wechsels der Gottesdienst-„Gemeinde“, die im Ablauf der Veranstaltungen ja keinerlei Konstanz aufweist; äußerlich namentlich in Hohenheim wegen des Fehlens eines eigenen Gottesdienstraums.
Dies sollte sich erst mit dem Erweiterungsbau und seiner Kapelle ändern. Für sie entwarf der Theolo-ge Gebhard Fürst ein interreligiös akzentuiertes theologisches Programm, das – bis in Einzelheiten der Ausstattung hinein – seine adäquate ästhetisch-künstlerische Umsetzung durch eine befreundete Künstlerschaft erfuhr. Die Früchte dieses Bemühens dürfen nun andere ernten. Bischof Gebhard war es aber vergönnt, „seine“ Kapelle am 2. Oktober 2000 zu weihen – sozusagen der Schlussstein des Hohenheimer Bauvorhabens.
Moderator – Mediator
Die Stiftung von Beziehungen, die Pflege von Verbindungen, das Knüpfen eines Kontakt- und Kommunikationsnetzes – darin kamen Stärken und menschliche Begabung von Gebhard Fürst markant zum Tragen. Davon profitierte die Akademie unter seiner Leitung reichlich, in vielfältiger Hinsicht und auf vielen Ebenen. Seine kontinuierliche Präsenz in der Sitzung des Bischöflichen Ordinariats verschaffte der Akademie am Sitz der Kirchenleitung eine respektierte Stimme und über die Jahre hin merklich wachsende Aufmerksamkeit. Mehr und mehr waren dort Sachkompetenz, Erfahrungen der Akademie und Ergebnisse ihrer Arbeit gefragt, mehr und mehr schließlich auch ihr Direktor selbst als unbefangener Moderator kontroverser Diskussionen oder als beschlagener Mediator in der Darstellung und Entwicklung komplexer Sachverhalte.
Letztlich ist es auch dem kompromisslosen Einsatz von Dr. Fürst dort zu verdanken, dass die Akademie im Zuge der ökonomischen und administrativen Zentralisierung der diözesanen Bildungshäuser ihre Eigenständigkeit (bis jetzt) bewahren konnte. Der dafür zu zahlende Preis – eine wesentliche Erhöhung der eigenwirtschaftlich zu erbringenden Kennziffern – erschien ihm weniger als Risiko denn als Gebot der ökonomischen Vernunft, so oder so. Diese Weichenstellung forderte große Opfer, namentlich vom Personal unserer beiden Tagungshäuser. Doch die Ergebnisse versprechen, die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges nachhaltig zu bestätigen.
Sein Verhältnis zum Kuratorium der Akademie war von zwei Gedanken hauptsächlich bestimmt: dessen beratende Funktion durch Zugewinn an Sachverstand, d.h. entsprechende Berufungen, zu stärken und die Repräsentation der Akademie im kirchlichen, gesellschaftlichen und öffentlichen Bereich durch geeignete, ihr in Intention und tätiger Absicht verbundene Persönlichkeiten zu verstärken. Daraus wuchs dem Kuratorium fast von selbst die Rolle einer gewissen Interessenvertretung zugunsten der Akademie in Kirche und Öffentlichkeit zu – eine mehrfach erfolgreiche Allianz.
Ein Novum stellte schließlich die von Gebhard Fürst mit langem Atem betriebene Gründung der Vereinigung von Freunden und Förderern der Akademie der Diözese Rottenburg- Stuttgart – „Akademieverein“ dar. Der Verein fördert bestimmte Projekte der Akademie wirtschaftlich und ideell und wirbt durch seine Mitglieder für die Akzeptanz ihrer Arbeit unter Multiplikatoren in Kirche und Gesellschaft. Was 1995 mit 17 Gründungsmitgliedern begann, steht heute mit weit über 300 Mitgliedern immer noch auf erfreulichem Wachstumskurs.
Unbestechliche Zahlen
Mögen Statistiken lügen – ohne Statistik würde noch fröhlicher gelogen! Die Chroniken der Jahre des Direktorats Fürst weisen Zahlen aus, die in ihrer Entwicklung schlicht beeindrucken, vergleicht man als Eckpunkte das erste (1987) und das letzte (1999) Voll-Jahr unter seiner Leitung. Die Akademie verzeichnete 1987 in ihren beiden Tagungshäusern Hohenheim und Weingarten und auswärts zusammen 111 eigene Veranstaltungen mit insgesamt 6.331 Teilnehmern; dazu 140 Gasttagungen mit 4.898 Teilnehmern; in Summe: 251 Veranstaltungen mit 11.229 Gästen. 1999 liest sich die Bilanz (in gleicher Reihung) so: 162 eigene Veranstaltungen mit insgesamt 12.166 Teilnehmern; dazu 194 Gasttagungen mit 6.784 Teilnehmern sowie 2.157 Einzelgäste; in Summe: 356 Veranstaltungen mit 21.107 Gästen.
Man mag die genannten Zahlen drehen und wenden wie man will: Jedes Jahr war in allen Sparten ein kontinuierlicher, gelegentlich auch sprunghafter Zuwachs zu verzeichnen. Besonders der in Hohenheim und Weingarten ab 1996 systematisch intensivierte Garni-Bereich erwies sich als wirtschaftlich mittragender Wachstumsfaktor. Das Resultat: Die wirtschaftliche Bilanz des Hauses kann sich am Ende wirklich sehen lassen und sich selbstbewusst einer unbefangenen Prüfung stellen.
Trotz aller schmerzlichen Begleiterscheinungen zeigte sich Gebhard Fürst aber auch hier gleichermaßen als Realist wie als geschickter Steuermann: Die Akademie hatte die zu erbringenden „Sparziele“ zum jeweils gesetzten Termin ohne Wenn und Aber erbracht!
Ein Tagungszentrum zum Abschied
Fünf Jahre dauerte es von den ersten Planungen bis zur Eröffnung am 1. Januar 2000 – dann konnte Direktor Fürst, im Jahr zuvor zum Päpstlichen Ehrenkaplan mit dem Titel Monsignore ernannt, das um einen Flügel erweiterte Tagungszentrum in Hohenheim seiner Bestimmung übergeben. Anbau? Neubau? Vordergründig und nominell jedenfalls ein „Erweiterungsbau“, hintergründig die Erweiterung einer Idee und eines Programms, ihre Darstellung in gebauter Form – eine zu Geistes-Gegenwart verpflichtende Aufgabe also, über das Aufrichten von Wänden hinaus ein Höchstmaß an Reflexion und kulturellem Handeln verlangend. „Ein schwungvolles Zeichen des Dialogs“ hatten die Zeitungen als Titel über ihre Berichte zur kreativen Verbindung von renoviertem Altbau und dem von Prof. Arno Lederer und seinem Büro entworfenen Neubau gesetzt. Das Tagungszentrum an der Paracelsusstraße in Hohenheim fand überall Wohlgefallen, zum einen seines originellen Gepräges halber, zum anderen wegen der (alle Erwartungen übertreffend) günstig ausgefallenen Baukosten. Gebhard Fürst durfte es sich zugute halten, dass er die Kalkulationen und deren Einhaltung trefflich im Griff hatte. „Fit machen“ wollte er die Akademie für das dritte Jahrtausend. Und so ist das Zentrum ausgerüstet mit modern eingerichteten Zimmern, Sälen und Konferenzräumen mit Technik auf der Höhe der Zeit und – zum Zeichen ökologischen Verantwortungsbewusstseins – mit einem solar betriebenen Stromkraftwerk.
Zu den weit reichenden und nachhaltigen Spuren, die Gebhard Fürst nach den gut 14 Jahren seines Direktorats hinterlässt, gehört nun also auch dies: als weithin erkennbares Zeichen geistiger Zeitgenossenschaft ein Tagungszentrum, das noch besser als bisher Raum zum Dialog bietet, zur Weitung des Horizonts, zur Erfahrung von Gastfreundschaft.
Die Akademie dankt
Am 8. März 1986 feierte die Akademie der Diözese Rottenburg- Stuttgart den „Stabwechsel“ im Amt des Direktors von Heinz Tiefenbacher zu Gebhard Fürst. Am 1. Juni dann trat Gebhard Fürst sein Amt definitiv an. Von da ab galt sein Leben – mit der Strenge des ersten Gebots – der Akademie. Man kann die Zeit seines Direktorats unmöglich anders bezeichnen denn als „Ära“. Eine Ära – schon den Jahren nach: Es war mit Abstand die längste eines Direktors unserer Akademie. Eine Ära vor allem aber dem markanten Profil, der gestaltenden Kraft und den effektiven Ergebnissen nach! Umfang und Profil der Arbeit unserer Akademie und deren öffentliche Wahrnehmung haben in der Amtszeit von Gebhard Fürst zweifellos ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Und wie könnte man seinen persönlichen Einsatz für die Akademie anders bezeichnen als – sit venia verbo – wahnwitzig?
Am 27. Juni 2000 wählte das Hohe Domkapitel zu Martin in Rottenburg Dr. Gebhard Fürst zum elften Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Nach päpstlicher Bestätigung und öffentlicher Bekanntgabe der Wahl am 7. Juli beendete er seinen Dienst als Akademiedirektor mit seiner Bischofsweihe am 17. September 2000. Besser als alle „Nachrufe“ vermögen die dem neuen Bischof damals vorauseilenden Schlagzeilen zu charakterisieren, was leitende Ideen, gesteckte Ziele und formgebender Stil seiner Amtszeit waren: „Weltoffen, kollegial und immer auf der Höhe der Zeit“ – „Ein sehr liberaler, aufgeschlossener Geist“ – „Kein romhöriger Frömmler“ – „Ein liebenswürdiger Manager auf dem Bischofsstuhl“ ... Die Akademie dankt!
Buchtipp:
Zum altersbedingten Rücktritt von Dr. Gebhard Fürst als Diözesanbischof ist auch eine Biographie über ihn erschienen:
Thomas Broch, „Um unseres Heiles willen" – Gebhard Fürst. Der Weg eines Bischofs", Schwabenverlag, 4456 Seiten, 30 Euro
Zum Autor: Dr. Thomas Broch war Pressesprecher und später Flüchtlingsbeauftragter der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Heute engagiert er sich vor allem für die weltkirchliche Arbeit der Diözese.