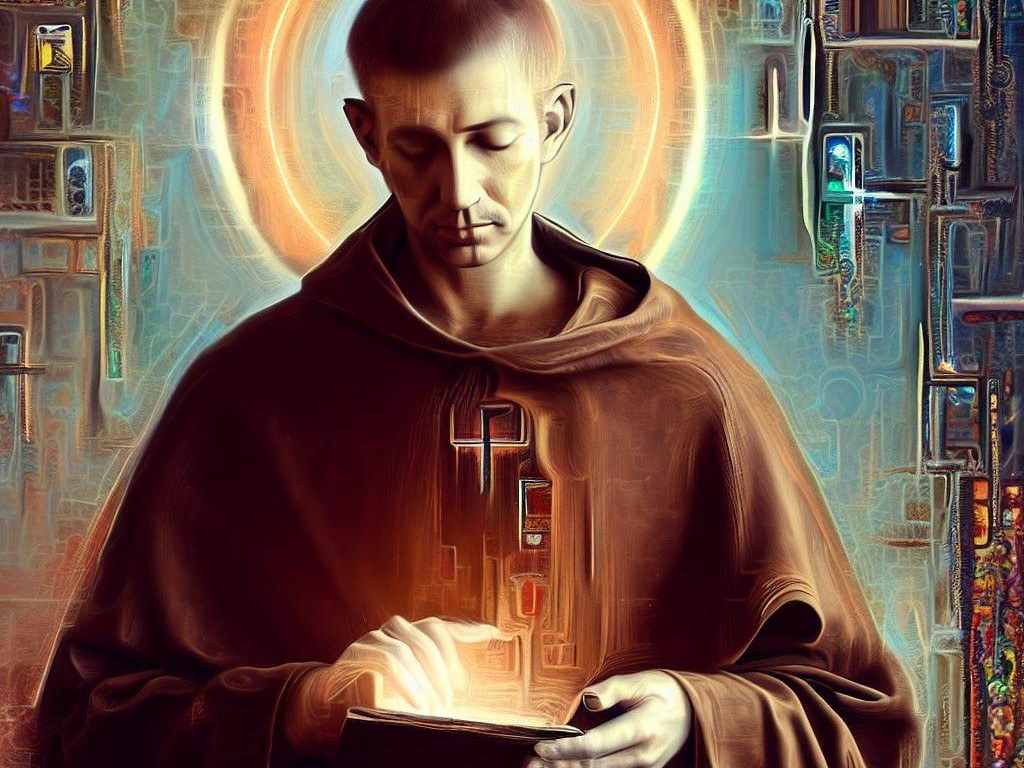Von Dominic Scheim
Jeder kennt sie: Die Heiligen der Kirche. Ob Schutzpatrone oder Namenspaten: die Lebens- und Wirkungsgeschichten von Märtyrern und Bekennern werden seit jeher aus verschiedenen Perspektiven beachtet, bewertet und gedeutet. Zwischen dem 23. und 25. März 2023 tagte der Arbeitskreis für hagiographische Fragen in Stuttgart-Hohenheim, um sich über neue Erkenntnisse aus Sicht der Geschichts- und der Literaturwissenschaften, der Theologie, der Kirchen- und Kunstgeschichte auszutauschen sowie aktuelle Forschungsprojekte zu diskutieren.
Gelegentlich sitzt man dem Trugschluss auf, die Geisteswissenschaften seien als Ganzes in ihren Methoden altmodisch und verstaubt. Doch wie Andreas Bihrer und Patrick Nehr-Baseler zeigten, ist selbst ein Spezialbereich wie die Hagiographie – also die wissenschaftliche Erforschung von Heiligenviten und anderer einschlägiger Quellen – für die digitale Revolution gerüstet. Unter dem Titel „Vernetzte Heiligkeiten“ stellten sie ihr Projekt vor, das im Bereich der Digital Humanities angesiedelt ist und zum Ziel hat, die Chancen, die das Internet und die digitale Welt bieten, für die hagiographische Forschung zu nutzen.
Dazu gehöre nicht nur die bloße Zugänglichkeit von Quellen. Vielmehr müsse alles gesammelte Wissen, auch das aus der Forschung, erfasst werden und über einheitliche Parameter gefunden und abgerufen werden können. Künftig könne dieses Wissen dann auch von künstlichen Intelligenzen ausgewertet und weiterverarbeitet werden. Um dieses Semantic Web zu erreichen, müssten – so Bihrer und Nehr-Baseler – zuerst alle Daten maschinenlesbar und unter Einhaltung von Normen erfasst werden. Dies wird allerdings erst möglich sein, wenn bereits bei Verfasser:innen von Forschungsarbeiten ein Umdenken einsetze, so dass gleich von Anfang an mit vernetzten Daten oder maschinenlesbaren Programmen wie Excel gearbeitet werde und nicht nur mit schwer verwertbaren pdf-Dateien. Das von den beiden Referenten vorgestellte Projekt steckt dabei noch in den Anfängen und wird vor allem dadurch erschwert, dass viele der bereits jetzt erfassten Daten nicht verifiziert oder offensichtlich falsch sind. Erst mit der fortschreitenden Einspeisung seriöser wissenschaftlicher Daten wird unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz eine Aussortierung der fehlerhaften Informationen vorgenommen werden können, womit die Daten überhaupt erst nutzbar wären.
Die protestantische Sicht
Ein gänzliches anderes Thema bereitete Antje Sablotny auf, indem sie auf die Rezeption von Legenden des Hl. Franziskus von Assisi im Protestantismus einging. Gemein sei der protestantischen Betrachtungsweise, dass sie die Wundertätigkeit des populären Heiligen ablehne und derartige Erzählungen als „Lügenden“ abwerte. Dennoch ist laut Sablotny eine gewisse Ambivalenz zu spüren. Zwar wird einerseits Franziskus auch in der evangelischen Kirche als Heiliger geführt, sein Personenkult aber abgelehnt. Doch auch darin werden Divergenzen deutlich. Während einige Historiographen Franziskus einer Selbsterhöhung um des Egos willen bezichtigen, sehen andere seine Brüder in der Verantwortung. Diese hätten, um die Stellung des Ordens gegenüber der Weltkirche zu stützen, Franziskus nach seinem Ableben Wundmale, Wunder und noch größere Tugendhaftigkeit zugeschrieben.
Und genau mit den franziskanischen Orden hatte der Protestantismus seine Schwierigkeiten. Grund war die starke Bindung dieser geistlichen Gemeinschaften an das Papsttum, das in Zeiten des frühen Protestantismus auf allen Ebenen Ablehnung erfuhr. Die Mönche traten als Bettelorden in allen Städten Europas auf und erreichten durch die Standorte ihrer Klöster große Teile der Bevölkerung, stellten also auf diese Weise auch einen wichtigen Gegner für die verschiedenen Reformationsanliegen dar. Somit steht hinter der Ablehnung der Franziskus-Legenden in nicht unbeträchtlicher Weise die Bekämpfung der von ihm gegründeten Orden, womit wiederum der religiös-politische Komplex der Reformation gestützt werden sollte. Dennoch dürfte auch die moralische Ablehnung gegenüber Franziskus, dessen überhöhte Darstellung auch als Konkurrenz zu Jesus Christus gesehen wurden, nicht unbedacht gelassen werden.
Weitere Beiträge der international besetzten Tagung widmeten sich unter anderem den asketischen ‚Säulenheiligen‘ der Spätantike, mittelalterlichen Erzählungen über Reliquienfunde, Raffaels Tapisserien für die Sixtinische Kapelle oder den lateinischen Viten sogenannter „transvestitischer Heiliger“.
Im kommenden Jahr wird sich der Arbeitskreis für hagiographische Fragen anlässlich seines 30. Jubiläums zu einer großen Tagung von 10. bis 13. April in Stuttgart-Hohenheim zusammenfinden.