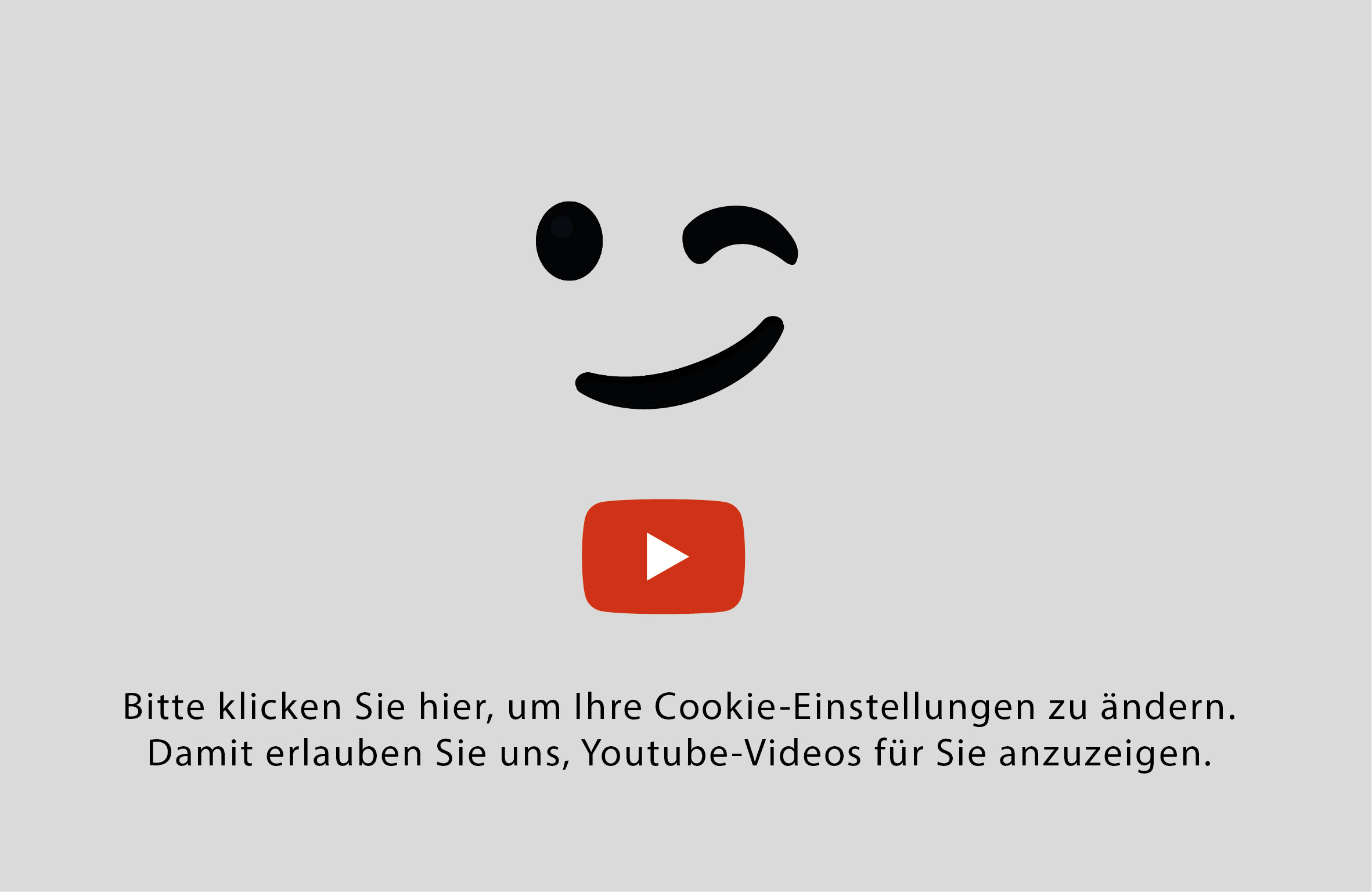Von Elena Winterhalter
Markus Müller begann den Abend aus der Reihe „Wirtschaft im Wandel“ mit einem Impulsvortrag über den Ist-Zustand in Deutschland und die Größenordnung der Herausforderungen, die uns als Gesellschaft erwarten. Dabei gab der Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg einen Überblick über die Fragen, warum wir klimagerecht bauen müssen, worum es dabei geht und warum es so schwerfällt, die Ziele umzusetzen. Große Fragen also, die Müller im Gespräch mit Barbara Thurner-Fromm von der Akademie in verständlichen und klaren Aussagen beantwortete. Der Bundesrepublik Deutschland stellte er dabei ein schlechtes Zeugnis aus. „Wir sind als Gesellschaft nicht auf der Seite der Guten, wenn wir Klimaschutz betreiben“, betonte er. Vielmehr würde man nur den überproportional hohen Ressourcenverbrauch, den Deutschland lange betrieb und immer noch betriebt, etwas abmindern. Es sei ein Armutszeugnis, dass Verträge wie das Pariser Klimaabkommen nicht ernst genommen würden: „Wir müssen uns bemühen, diese nationalstaatlichen Verträge zu erfüllen. Und das machen wir als Bundesrepublik Deutschland nicht.“
Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Das Thema Klimagerechtes Bauen sei von der Politik lange verschlafen worden. Das führe dazu, dass die Finanzierbarkeit immer mehr in Frage steht und damit auch die Leistbarkeit. „Es ist eine existenzielle Glaubwürdigkeitsfrage auch für unseren Berufsstand, dass wir dieses Thema auf der Agenda haben”, so der Architekt. Klimagerechtes Bauen habe es in sich. Es sei höchst komplex und umfasse weit mehr als das Gebäude selbst. Angefangen bei der Flächeneffizienz eines Grundstücks, über Baustoffe, Konstruktion, Abbau, effiziente Planungsmechanismen und den Müll auf der Baustelle: Die Liste der zu beachtenden Punkte ist lang.
Hinter dieser Erkenntnis stecke nicht nur eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, sondern auch ein enormes Potenzial, zeigte sich Müller optimistisch. Deutschland sei zugegebenermaßen verglichen mit anderen EU-Ländern eher Schlusslicht als Vorreiter. Die Gesellschaft könne der Aufgabe aber gewachsensein: „Wir müssen das Prinzip Soziale Marktwirtschaft in Gang setzen und nicht das Prinzip Hoffnung.“ Soll heißen: Diejenigen, die im Sinne des Kilmaschutzes handeln, müssten finanziell besser gestellt werden als die anderen."
Rückbesinnung auf das Wesentliche
„Endlich anfangen“, fordert auch Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. „90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden“, betont die Bauingenieurin. Umso verwunderlicher sei es, dass klimagerechtes Bauen immer noch nicht höher auf der politischen Agenda stehe. Dass am Entstehen eines Gebäudes so viele Sektoren beteiligt seien, erschwere die Unterscheidung, wo welche Klimabelastungen anfallen. Ökonomie, Ökologie und Sozialverträglichkeit dürften keine Widersprüche sein, betonte Lemaitre, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Dabei gehe es auch schlichtweg um eine Rückbesinnung auf das Wesentliche und den Mut, unnötige Dinge wegzulassen. Und manchmal helfe schon der gesunde Menschenverstand: „Uns allen ist doch klar, dass es keinen Sinn macht, Sondermüll zu produzieren.“
Mittlerweile sei das Handlungsfenster eng geworden, um dem Klimaschutz noch gerecht werden zu können. „Wir haben noch ein Zeitfenster von zehn Jahren, um die Emissionen drastisch zu reduzieren“, rechnet Lemaitre vor: „Aber wir fangen einfach nicht an.“ Zwei Worte, auf die Lemaitre deshalb allergisch reagiert: Ja, aber . . . „Das will ich wirklich nicht mehr hören.“
Dieser Artikel ist Bestandteil unserer Reihe „Wirtschaft im Wandel“:
Teil 6: Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Kai Burmeister, Gewerkschaftssekretär der IG-Metall
Teil 5: Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen) und Johannes Schmalzl, Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart
Teil 4: Sven Hahn, Stuttgarter Citymanager, und Christian Riethmüller, Geschäftsführer der Osianderschen Buchhandlung
Teil 2: Thomas Pilz, Geschäftsführer der Pilz GmbH und Co KG aus Ostfildern
Teil 1: Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VAUDE