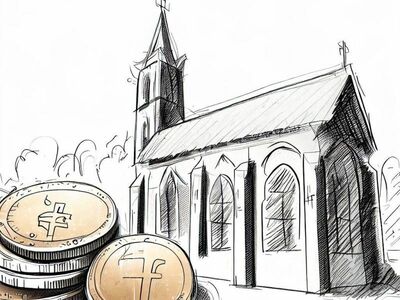Von Markus Waggershauser
Die Kirchen und das liebe Geld, das ist ein heikles Thema. Zumal in Deutschland, wo der Staat im Auftrag der Religionsgemeinschaften Steuern eintreibt und den Kirchen zusätzlich Staatsleistungen zahlt. Laut einer Umfrage des INSA-Consulere-Instituts in Erfurt lehnten sogar 71 Prozent der Kirchenmitglieder die Kirchensteuer ab, berichtete Johannes Kuber von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und die Ampel-Koalition ihrerseits hat sich zum Ziel gesetzt, die Staatsleistungen abzulösen – und damit einen Auftrag zu erfüllen, der seit 1919 zuerst in der Weimarer Verfassung und bis heute im Grundgesetz steht.
Bei der Tagung „Ohne Moos nix los...“ in Kooperation von Akademie und Geschichtsverein der Diözese erläuterten Expert:innen in Weingarten, wie dieses Finanzierungssystem überhaupt zustandekam und wer davon profitiert. Generalvikar Clemens Stroppel stellte sich im Rahmen eines Podiumsgesprächs Fragen zum Ablöseprozess. Er hatte als Vertreter des Verbands der Diözesen Deutschlands (VDD) an den Gesprächen mit Bund und Ländern teilgenommen.
Kirchen bei Staatsleistungen verhandlungsbereit
„Ein Verfassungsauftrag ist zu erfüllen“, begründete Stroppel die kirchliche Verhandlungsbereitschaft. Die Kirchensteuer mache nach Abzug der Verwaltungsgebühr an den Staat, diversen Ausgleichszahlungen und des hälftigen Anteils für die Kirchengemeinden mit etwa 263 Millionen Euro knapp zwei Drittel der Einnahmen im Diözesanhaushalt aus, berichtete der Generalvikar. Die Staatsleistungen – ohne Ersatz für Tätigkeiten der Kirche etwa im sozialen Bereich – bringen ungefähr 34 Millionen Euro ein, also nur etwa 7,5 Prozent des diözesanen Haushalts.
Ende des 18. Jahrhunderts sei das dem volkswirtschaftlichen Kreislauf entzogene Kirchenvermögen als „tote Hand“ bezeichnet worden, sagte Professor Dominik Burkard zum Auftakt des Podiumsgesprächs. Der aus Rottweil stammende Würzburger Kirchenhistoriker und Vorsitzende des Geschichtsvereins verwies auf den anderweitig ungenutzten kirchlichen Grundbesitz, dessen Erträge die Gehälter der Kleriker und deren Arbeit sicherten. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 brachte eine einschneidende Veränderung. „Etwa 90 Prozent des kirchlichen Vermögens ging in staatlichen Besitz über“, betonte Burkard bei der Tagung.
Der Staat hat sich selbst zu Zahlungen verpflichtet
Auch der zum Kurfürsten beförderte evangelische Herzog und spätere König Friedrich I. von Württemberg erhielt ehemaligen Kirchenbesitz als Entschädigung für seine linksrheinischen Ländereien, die an Napoleon gefallen waren. In den Folgejahren kamen weitere katholische Gebiete dazu. Der Staat habe sich daher selbst in der Pflicht gesehen, für die Ausstattung der katholischen Kirche zu sorgen, bemerkte Burkard. Zumal Friedrich die Gründung einer eigenen Diözese in den Grenzen seines Reiches vorantrieb. Diese – in nachhaltigerer Weise – aufs Neue mit Grundbesitz anstelle von regelmäßigen Geldzahlungen auszustatten, sei jedoch politisch nicht durchsetzbar gewesen.
Ob die im Rahmen der Säkularisation erfolgten Enteignungen mit den seit zwei Jahrhunderten geleisteten Zahlungen heute nicht längst zurückerstattet seien, fragte Moderator Paul Kreiner von der Akademie den Generalvikar. Stroppel fragte zurück: „Wenn ein Grundstück 30.000 Euro wert ist und der Pächter hundert Jahre lang jeweils 300 Euro bezahlt, gehört das Grundstück dann ihm?“ Und er verwies auf die konstruktiven Gespräche, zu denen das Bundesinnenministeriums (BMI) eingeladen hatte – zunächst auch mit den Bundesländern.
Faire Ablösung bedeutet Gleichwertigkeit
Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel-Regierung einen „fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen“ zum Ziel gesetzt. Für Stroppel bedeutet das zu garantieren, dass die Kirchen von den Erträgen aus der Ablösesumme auch künftig das leisten können, was sie heute mit den staatlichen Zahlungen schaffen. Die Enteignungen von 1803 im einzelnen Klein-Klein als Grundlage nachzurechnen, halten sowohl die staatliche als auch die kirchliche Seite für zu zeitaufwändig und utopisch. Im Raum steht nun – vorgeschlagen in einem gemeinsamen Gesetzentwurf von FDP, Linken und Grünen – als Ablösesumme das 18,6-fache einer derzeitigen Jahresleistung; dieser Faktor müsste allerdings laut Stroppel unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Jahresinflation von zwei Prozent noch höher ausfallen.
Den Bundesländern wiederum als den Rechtsnachfolgern der deutschen Kleinstaaten von damals und damit als Zahlungspflichtige von heute war der Faktor zu hoch. Sie stoppten die Verhandlungen – zumindest bis nach den Landtagswahlen im Herbst. Der Generalvikar, der auf eine streitfreie Lösung der Partner setzt, rechnet damit, dass der Bund auf eine Fortsetzung der Gespräche drängt. Als Lösung könnte sich Stroppel auch Ratenzahlungen, doppelte Zahlungen auf mehrere Jahre oder eine Ablösung mit Staatsanleihen vorstellen. Und er verweist darauf, dass bei der Diözese jährlich 200 Millionen Euro in Gehälter fließen. „Da bekommt der Staat an Steuern mehr zurück, als er derzeit zahlt.“
Bei der Kirchensteuer profitieren Staat und Religionsgemeinschaften
Auch die Kirchensteuer übrigens hat der Staat eingeführt. Im Jahr 1887 habe Württemberg dafür die „Stolgebühren“ für liturgische Sonderleistungen der Pfarrer (etwa Taufen oder Beerdigungen) abgeschafft, erklärte Kirchenrechtlerin Anna Ott. Dabei habe der Staat jedoch einen Teil seiner Verpflichtungen gegenüber den Kirchen auf deren Mitglieder abgewälzt, gab Professor Burkard zu bedenken. Nach anfänglicher Ablehnung hätten die Religionsgemeinschaften die Chancen einer verlässlichen Finanzplanung erkannt, berichtete Ott. Die Weimarer Verfassung und die Staatskirchenverträge hätten das Recht auf Kirchensteuer dann deutschlandweit festgeschrieben.
Dieses Recht stehe nach dem Gleichheitsgrundsatz allen weltanschaulichen Gemeinschaften offen, betonte Kirchenrechtlerin Ott. Und der Staat musste im Sinne der Religionsfreiheit auch das Recht zum Austritt einräumen, der bis heute – je nach Bundesland – beim Standesamt oder beim Amtsgericht zu vollziehen ist. Obwohl in der Gesellschaft der Ruf nach Abschaffung der Kirchensteuer lauter wird, profitierten Staat und Kirche vom System. Für die Kirche sei der Einzug über den Staat günstiger, und der Staat lasse sich diese Leistung gut bezahlen. Die Kirche müsse der Öffentlichkeit jedoch besser erklären, für was sie die Steuer verwende, kam mehrfach die Forderung aus dem Publikum.