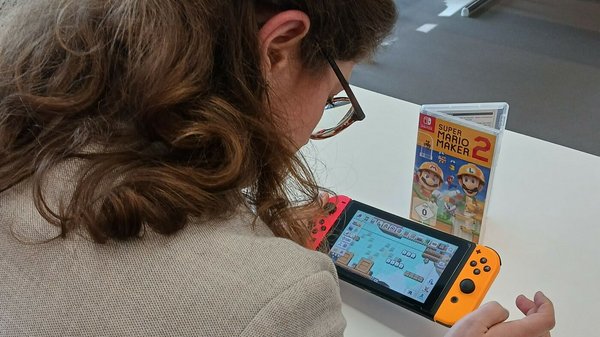Von Linda Huber
Wer vor 30 Jahren gefragt wurde, konnte noch ziemlich einfach erklären, was „Gaming“ ist: Von „Arcade Pong“ bis „Pac-Man“, also von 1972 bis 1980, war die Entwicklung doch recht linear, wie Sebastian Demuth vom SWR X Lab schmunzelnd anmerkte. In seinem Impulsvortrag nahm er die Teilnehmer:innen der Hybrid-Tagung „Gaming bildet?!“ mit in die Welt der digitalen Spiele. Mittlerweile würden im Spiele-App-Store „Steam“ jährlich mehr als 10.000 neue Games veröffentlicht, sagt Demuth. Untereinander könnten diese kaum verschiedener sein. Sie ermöglichten auch ein Lernen auf vielfältige Art und Weise.
Der Games-Markt ist ein Millionengeschäft, die wirtschaftliche Bedeutung der Branche unstrittig. Zugleich seien Computerspiele in der öffentlichen Debatte lange wie Schundliteratur im 19. Jahrhundert behandelt worden – also wie triviale und potenziell schädliche Produkte, hob Prof. em. Johannes Fromme in seiner Keynote hervor. Dabei seien digitale Spiele „in mindestens zweierlei Hinsicht kulturell bedeutsam“. Aus der alltäglichen Medienkultur seien sie nicht mehr wegzudenken, zudem stelle das digitale Spiel eine Kunstform dar. Betrachte man digitale Spiele unter dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive, werde ihr Potenzial, die mentale Herangehensweise an die Welt zu erneuern, offensichtlich. Indem Spieler:innen in fremde Settings und Charaktere schlüpfen, erweitern sie beispielsweise – so Fromme – ihre eigene Perspektive und werden zu Reflexionsprozessen angeregt.
„Computerspiele gehören in die Schule!"
Prof. Dr. Jan Boelmann von der Pädagogischen Hochschule Freiburg fordert deshalb: Computerspiele gehören in den Unterricht! Der Leiter des Zentrums für Didaktische Computerspielforschung (ZfdC) sagt: „Games eignen sich als interaktive Handlungsmedien hervorragend, um Lernprozesse anzustoßen.“ Sie forderten zu Kommunikation und Kollaboration auf, wirkten kognitiv aktivierend und schulten Problemlösungskompetenzen. Für Lehrer:innen könne es aber ganz schön herausfordernd sein, die richtigen Spiele auszuwählen. Denn nicht immer könne mittels digitalen Spielen besser gelernt werden. Wichtig sei, dass intrinsisches Lernen gefördert und nicht einfach stupide Punkte gesammelt würden.
„APPettit" auf den Einsatz von digitalen Medien machten am Nachmittag beispielsweise Ursi Zeilinger und Peter Bernstein vom SWR, die in ihrem Workshop das Klima-Spiel von Planet Schule vorstellten. Hier können Nutzer:innen zu verschiedenen Forschungsstationen der Welt reisen, um die wesentlichen Methoden und die Zusammenhänge der Klimaforschung kennenzulernen.
Wie vielseitig die Dauerbrenner Minecraft und Minetest in der Schule eingesetzt werden können, zeigte Pfarrer Thomas Ebinger in einem Workshop auf. In München habe man mittels Minecraft junge Menschen für die Partizipation an Stadtentwicklungsprojekten begeistern können, erzählte Sebastian Ring, Leiter des Medienzentrums München und Referent am Institut für Medienpädagogik. Spiele seien für die offene Kinder- und Jugendarbeit hilfreiche Tools, um junge Menschen auch für dröge Themen zu begeistern und Interaktion anzuregen. Außerdem könne man sie bestens als Anknüpfungspunkte nutzen, um beispielsweise über ethische Fragen zu reflektieren. Zugleich forderte er, eine kinderrechtliche Perspektive auf Games einzunehmen: Das Recht auf Spiel, verankert in der UN-Kinderrechtskonvention, werde noch nicht ausreichend beachtet. Junge Menschen bräuchten eine geschützte Umgebung, um sich im Rahmen ihrer Fertigkeiten, Interessen und Themen einzubringen und eigene Kompetenzen zu schulen.
Geschützter Raum für Frauen
Milena Imgart und Yannik Steinhart, Mitarbeiter:innen im Forschungsprojekt „DoMES“ (Doing Media Education in Esslingen) an der Hochschule Esslingen und selbst begeisterte Gamer:innen hoben hervor, dass die in Games angelegten Bildungspotenziale etwa hinsichtlich der Persönlichkeitsbildung auch in der angrenzenden Szene liegen. Auf dem deutschsprachigen Discord-Server „Girls love Gaming“ finden rund 1.500 Mädchen und Frauen einen Safe Space, um sich über Themen rund um Sexualität, mentale Gesundheit, Bildung oder Politik auszutauschen. Denn obwohl fast die Hälfte aller Gamer:innen weiblich sei, seien Frauen und Mädchen in den Gaming-Communities oftmals wenig sichtbar und hätten mit Vorurteilen zu kämpfen. Dr. Lisa König (ZfdC) und Adrian Zipfel (LFK) gaben in ihrem Workshop einen Überblick über unterschiedliche Darstellungsformen von Sex und Gender in digitalen Spielen und diskutierten mit den Teilnehmer:innen, wie populärkulturelle und aktuelle Beispiele der Gamesbranche unser Bild von (sozialem) Geschlecht prägen.
Zocken ist demnach mehr als nur ein Hobby. Die 45. Stuttgarter Tage der Medienpädagogik zeigten: Die Medienpädagogik hat die Bildungspotenziale von digitalen Spielen längst erkannt, nun müssen sie in der Praxis umgesetzt werden. Auch dazu bot der Fachtag ausreichend Anregungen: Gemeinsam mit der ComputerSpielSchule Stuttgart konnten die Teilnehmer:innen selbst aktiv werden und erleben, wie Gaming im informellen, non-formalen und formalen Bildungsbereich zum Lernen anregen kann.
Die Dokumentation zur Veranstaltung finden Sie unter: www.Stuttgarter-Tage.de